Details
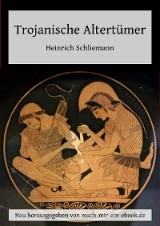
Trojanische Altertümer
1. Aufl.
|
2,99 € |
|
| Verlag: | Mach-Mir-Ein-Ebook.de |
| Format: | EPUB |
| Veröffentl.: | 26.05.2013 |
| ISBN/EAN: | 9783944309224 |
| Sprache: | deutsch |
| Anzahl Seiten: | 380 |
Dieses eBook erhalten Sie ohne Kopierschutz.
Beschreibungen
In diesem Buch berichtet Heinrich Schliemann von den ersten drei Grabungsjahren von 1871 bis 1873 in Troja. Dieses erstmals 1874 erschienene Buch wurde von ihm selbst finanziert und erschien in einer Auflage von nur 1000 Exemplaren.
In 23 Briefen und einem ausführlichen Vorwort berichtet er über seine Grabungen sowie über seine Funde, darunter der berühmten Schatz des Priamos. Auch seine Überlegungen zu Alter und Zweck der gefundenen Stücke sind in seinem Bericht enthalten. Schliemann scheut sich nicht, seine in älteren Berichten dargestellten Überlegungen zu revidieren und an Hand jüngerer Funde neu zu bewerten. Weiterhin gibt er einen Einblick in die Umstände und Schwierigkeiten, unter denen archäologische Ausgrabungen zu seiner Zeit durchgeführt wurden, sei es die Beschaffung von Material und Personal, die vielen christlichen Feiertage oder die osmanische Bürokratie.
Dieses E-Book wurde mit über 200 Abbildungen ergänzt, die im Original nur in einem Begleitband enthalten waren. Der Text wurde leicht modernisiert und mit einigen Anmerkungen versehen.
In 23 Briefen und einem ausführlichen Vorwort berichtet er über seine Grabungen sowie über seine Funde, darunter der berühmten Schatz des Priamos. Auch seine Überlegungen zu Alter und Zweck der gefundenen Stücke sind in seinem Bericht enthalten. Schliemann scheut sich nicht, seine in älteren Berichten dargestellten Überlegungen zu revidieren und an Hand jüngerer Funde neu zu bewerten. Weiterhin gibt er einen Einblick in die Umstände und Schwierigkeiten, unter denen archäologische Ausgrabungen zu seiner Zeit durchgeführt wurden, sei es die Beschaffung von Material und Personal, die vielen christlichen Feiertage oder die osmanische Bürokratie.
Dieses E-Book wurde mit über 200 Abbildungen ergänzt, die im Original nur in einem Begleitband enthalten waren. Der Text wurde leicht modernisiert und mit einigen Anmerkungen versehen.
Einleitung.
I. Auf dem Berg Hissarlik (in der Ebene von Troja), 18. Oktober 1871.
II. Auf dem Berg Hissarlik, 26. Oktober 1871.
III. Auf dem Berg Hissarlik, 3. November 1871.
IV. Auf dem Berg Hissarlik, 18. November 1871.
V. Auf dem Berg Hissarlik, 24. November 1871.
VI. Auf dem Berg Hissarlik, 5. April 1872.
VII. Auf dem Berg Hissarlik, 25. April 1872.
VIII. Auf dem Berg Hissarlik, 11. Mai 1872.
IX. Auf dem Berg Hissarlik, 23. Mai 1872.
X. Auf dem Berg Hissarlik, 18. Juni 1872.
XI. Auf dem Berg Hissarlik, 13. Juli 1872.
XII. Pergamos von Troja, 4. August 1872.
XIII. Pergamos von Troja, 14. August 1872.
XIV. Athen, 28. September 1872.
XV. Pergamos von Troja, den 22. Februar 1873.
XVI. Pergamos von Troja, 1. März 1873.
XVII. Pergamos von Troja, 15. März 1873.
XVIII. Pergamos von Troja, 22. März 1873.
XIX. Pergamos von Troja, 29. März 1873.
XX. Pergamos von Troja, 5. April 1873.
XXI. Pergamos von Troja, 16. April 1873.
XXII. Pergamos von Troja, den 10. Mai 1873.
XXIII. Troja, 17. Juni 1873.
Anhang 1
Anhang 2
I. Auf dem Berg Hissarlik (in der Ebene von Troja), 18. Oktober 1871.
II. Auf dem Berg Hissarlik, 26. Oktober 1871.
III. Auf dem Berg Hissarlik, 3. November 1871.
IV. Auf dem Berg Hissarlik, 18. November 1871.
V. Auf dem Berg Hissarlik, 24. November 1871.
VI. Auf dem Berg Hissarlik, 5. April 1872.
VII. Auf dem Berg Hissarlik, 25. April 1872.
VIII. Auf dem Berg Hissarlik, 11. Mai 1872.
IX. Auf dem Berg Hissarlik, 23. Mai 1872.
X. Auf dem Berg Hissarlik, 18. Juni 1872.
XI. Auf dem Berg Hissarlik, 13. Juli 1872.
XII. Pergamos von Troja, 4. August 1872.
XIII. Pergamos von Troja, 14. August 1872.
XIV. Athen, 28. September 1872.
XV. Pergamos von Troja, den 22. Februar 1873.
XVI. Pergamos von Troja, 1. März 1873.
XVII. Pergamos von Troja, 15. März 1873.
XVIII. Pergamos von Troja, 22. März 1873.
XIX. Pergamos von Troja, 29. März 1873.
XX. Pergamos von Troja, 5. April 1873.
XXI. Pergamos von Troja, 16. April 1873.
XXII. Pergamos von Troja, den 10. Mai 1873.
XXIII. Troja, 17. Juni 1873.
Anhang 1
Anhang 2
Einleitung.
Das vorliegende Werk ist eine Art von Tagebuch meiner Ausgrabungen in Troja, denn alle Aufsätze, woraus es besteht, sind, wie die Lebhaftigkeit der Schilderungen es beweist, an Ort und Stelle, beim Fortschreiten der Arbeiten, von mir niedergeschrieben.
Wenn meine Aufsätze hin und wieder Widersprüche enthalten, so hoffe ich, dass man mir diese zugute halten wird, wenn man berücksichtigt, dass ich hier eine neue Welt für die Archäologie aufgedeckt, dass man bis jetzt noch nie oder nur höchst wenige solcher Sachen gefunden, wie ich sie zu Tausenden ans Licht gebracht, dass mir daher alles fremd und rätselhaft erschien, und ich somit oft Vermutungen wagte, die ich bei reiflicher Überlegung wieder umwerfen musste, bis ich endlich zur gründlichen Einsicht gelangte und auf viele tatsächliche Beweise gegründete Schlüsse ziehen konnte.
Eine meiner größten Schwierigkeiten ist es aber gewesen, die enorme Schuttaufhäufung in Troja mit der Chronologie in Einverständnis zu bringen, und ist mir dies trotz langem Forschen und Grübeln nur teilweise gelungen. Nach Herodot (VII, 43): „kam Xerxes bei seinem Zug durch Troas vor seinem Einfall in Griechenland (also im Jahre 480 v. Chr.) am Skamander an und stieg zu Priams Pergamos hinauf, weil er das Verlangen hatte, diese Burg zu sehen; und nachdem er sie gesehen und sich nach ihren Schicksalen erkundigt hatte, opferte er der ilischen Minerva 1000 Rinder, und die Magier brachten den Manen der Helden Trankopfer dar".
Aus dieser Stelle geht stillschweigend hervor, dass damals eine griechische Kolonie schon seit langer Zeit die Stadt innehatte, und nach dem Zeugnis Strabos (XIII, I, 42) erbaute dieselbe Ilium unter der Herrschaft der Lydier. Da nun der Anfang der lydischen Herrschaft auf 797 v. Chr. festgestellt wird und die Ilier bei der Ankunft des Xerxes, im Jahr 480 v. Chr., dort längst vollkommen eingerichtet gewesen zu sein scheinen, so darf man wohl annehmen, dass ihre Niederlassung in Troja ungefähr 700 Jahre v. Chr. erfolgt ist. Die Hausmauern hellenischer Architektur, von großen Steinen ohne Zement, sowie die Überbleibsel des griechischen Hausgeräts, reichen aber in den Ausgrabungen auf der platten Fläche des Berges nie tiefer als 2 Meter.
Da ich in Ilium keine späteren Inschriften als vom 2. Jahrhundert n. Chr. und keine Medaillen später als Constans II. und Konstantin II., von diesen beiden Kaisern aber sowie von Konstantin I., dem Gossen, sehr viele finde, so ist bestimmt anzunehmen, dass schon vor der Zeit des letzteren, der bekanntlich anfänglich dort Konstantinopel zu bauen beabsichtigte, die Stadt in Verfall kam, jedoch ungefähr bis zum Ende der Regierung Constans’ II., sage bis 361 n. Chr., ein bewohnter Ort blieb. Aber die Schuttaufhäufung in dieser langen Periode von 1061 Jahren beträgt nur 2 Meter, während man unterhalb derselben noch 12 Meter oder 40 Fuß, und auf vielen Stellen gar 14 Meter oder 46½, Fuß tief zu graben hat, ehe man den Urboden erreicht, der aus einem Muschelkalkfelsen besteht. Diese gewaltige, 40 bis 46½ Fuß dicke Schuttdecke, welche von den vier verschiedenen Völkern herrührt, die, das eine nach dem anderen, den Berg vor Ankunft der griechischen Kolonie, also vor 700 v. Chr., bewohnt haben, ist ein unermesslich reiches Füllhorn der merkwürdigsten, bisher nie gesehenen Terrakottas und anderer Gegenstände, die nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit den Erzeugnissen hellenischer Kunst haben. Die Frage drängt sich nun auf: ob nicht diese enorme Trümmermasse vielleicht von einem anderen Ort hierher gebracht worden ist, um den Berg zu erhöhen? Eine solche Hypothese ist, wie sich jeder Besucher meiner Exkavationen auf den ersten Blick überzeugen kann, ganz unmöglich, weil man in allen Schuttschichten, vom Felsen in 14 und 16 Meter (46 bis 53½ Fuß) Tiefe ab bis zu 4 Meter unter der Oberfläche fortwährend Reste gemauerter Wände sieht, die auf starken Fundamenten ruhen und von wirklichen Häusern herrühren, und außerdem, weil alle die zahlreichen großen Wein-, Wasser- und Leichenurnen, denen man begegnet, aufrecht stehen. Die Frage ist dann: aber wie viele Jahrhunderte sind erforderlich gewesen, um von den Trümmern der vorgriechischen Haushaltungen eine Schuttdecke von 40 bis 46½ Fuß Dicke zu bilden, wenn zur Formierung der obersten, der griechischen Schuttdecke, von 2 Meter oder 6½ Fuß Dicke, 1061 Jahre erforderlich waren? Ich habe in meinen dreijährigen Ausgrabungen in den Tiefen Trojas täglich und stündlich Gelegenheit gehabt, mich zu überzeugen, dass wir uns, nach dem Maßstab unserer eigenen oder der altgriechischen Lebensweise, von dem Leben und Treiben der vier Völker, welche das eine nach dem anderen vor der Zeit der griechischen Ansiedlung diesen Berg bewohnt haben, gar keinen Begriff machen können; es muss heillos bei ihnen zugegangen sein, denn sonst könnte man nicht in beständiger unregelmäßiger Reihenfolge auf den verschütteten Resten des einen Hauses die Wände eines anderen finden; und eben weil wir uns keinen Begriff davon machen können, wie diese Nationen gewirtschaftet und welche Kalamitäten sie zu ertragen gehabt haben, können wir unmöglich nach der Dicke ihrer Trümmer die Dauer ihrer Existenz auch nur annähernd berechnen. Höchst merkwürdig, aber durch die fortwährenden Kalamitäten, welche diese Stadt befallen haben, vollkommen erklärlich ist es, dass bei allen vier Völkern die Zivilisation stets abgenommen hat; die Terrakotten, welche fortwährende décadence zeigen, lassen keinen Zweifel darüber.
Die erste Ansiedlung dieses Berges scheint jedenfalls von längster Dauer gewesen zu sein, denn ihre Trümmer bedecken den Felsen bis zu einer Höhe von 4 und 6 Meter. Ihre Häuser und Festungsmauern waren von großen und kleinen, mit Erde verbundenen Steinen gebaut, und sieht man mehrfach Reste davon in meinen Ausgrabungen. Ich glaubte im vorigen Jahr, diese Ansiedler seien identisch mit den von Homer besungenen Trojanern, weil ich bei ihnen Bruchstücke des Doppelbechers, des homerischen δέπας ἀμφιχύπελλον gefunden zu haben vermeinte. Bei genauer Prüfung hat es sich aber herausgestellt, dass diese Bruchstücke von einfachen Bechern mit hohlem Fuß herrühren, der nie als zweiter Becher gebraucht sein kann. Überdies glaube ich in meinen diesjährigen Aufsätzen hinreichend bewiesen zu haben, dass Aristoteles (Hist. anim., IX, 40) irrtümlich dem homerischen δέπας ἀμφιχύπελλον die Gestalt einer Bienenzelle gibt, dass man von jeher diesen Becher fälschlich als Doppelbecher aufgefasst hat, und dass er nichts anderes bedeuten kann als: Becher mit einem Henkel an jeder Seite, wie solche in den Trümmerschichten der ersten Ansiedlung dieses Berges niemals, dagegen in jenen des folgenden Volkes in großen Massen, auch bei den beiden späteren Nationen, die hier der griechischen Kolonie vorausgegangen sind, vielfach vorkommen. Der große, 600 Gramm wiegende goldene Becher mit zwei Henkeln, den ich im königlichen Schatz, in 8½ Meter Tiefe, in den Trümmerschichten des zweiten Volkes fand, lässt in dieser Hinsicht keinen Zweifel übrig.
Die Terrakotten, welche ich in 14 Meter Tiefe auf dem Urboden fand, sind alle so ausgezeichneter Qualität, wie sie in keiner der höheren Schichten vorkommen; sie sind glänzend schwarz, rot oder braun, und haben eingeschnittene, mit einer weißen Masse gefüllte Verzierungen; die Schalen haben an zwei Seiten horizontale Röhren, die Vasen haben meistenteils an jeder Seite zwei senkrechte Röhren zum Aufhängen mit Schnüren; von bemaltem Terrakotta fand ich nur ein Bruchstück.
Alles was sich über die ersten Ansiedler sagen lässt, ist, dass sie arischen Stammes waren; dies beweisen zur Genüge die in ihren Trümmerschichten, sowohl auf den Topfscherben als auf den kleinen merkwürdigen durchbohrten Terrakottas in Gestalt des Vulkans und des Karussells vorkommenden indogermanischen religiösen Symbole, unter welchen man auch die Swastika sieht.
Dr. Schliemann verwendet für die verschiedenen bemerkenswerten Objekte das Wort Karussell, als Übersetzung aus dem italienischen fusaioli, Spinnwirtel oder Spindel. Diese Wort wurde auch für die Altertümer verwendet, die in den Sümpfen von Modena gefunden wurden. (Anm. der englischen Ausgabe)
Meine diesjährigen Ausgrabungen haben zur Genüge bewiesen, dass die zweite Nation, die auf diesem Berg, auf den 4 bis 6 Meter oder 13 bis 20 Fuß hohen Trümmern der ersten Ansiedler, eine Stadt erbaute, die von Homer besungenen Trojaner waren, deren Schuttschichten in 7 bis 10 Meter oder 231⁄3 bis 331⁄3 Fuß unter der Oberfläche sind. Diese trojanischen Trümmerschichten, welche ohne Ausnahme das Gepräge großer Glut tragen, bestehen hauptsächlich aus roter Holzasche und bedecken 1½ bis 3 Meter hoch Iliums großen Turm, das doppelte Skaeische Tor und die große Ringmauer, deren Bau Homer dem Neptun und dem Apollo zuschreibt, und beweisen, dass die Stadt durch eine furchtbare Feuersbrunst zu Grunde ging. Wie groß die Glut gewesen ist, zeigen auch die großen Steinplatten des vom doppelten Skaeischen Tor zur Ebene hinunterführenden Weges; denn als ich diesen Weg vor einigen Monaten bloßlegte, sahen alle Steinplatten so unversehrt aus, als wenn sie erst kürzlich gelegt worden wären; nachdem sie aber einige Tage der Luft ausgesetzt gewesen waren, fingen, auf einer Strecke von 3 Meter, die Platten des oberen Teils des Wegs, welcher der Glut ausgesetzt gewesen war, an wegzubröckeln und sind jetzt beinahe schon verschwunden, während diejenigen des unteren Teils des Wegs, welcher vom Feuer unberührt geblieben war, durchaus unversehrt geblieben sind und unverwüstlich zu sein scheinen. Ein weiteres Zeugnis von der furchtbaren Katastrophe gibt eine ½ bis 3 Zentimeter dicke Schlackenschicht aus geschmolzenem Blei-und Kupfererz, die sich in 8½ bis 9 Meter Tiefe fast durch den ganzen Berg ausdehnt. Dass Troja nach blutigem Kampf vom Feind zerstört wurde, dafür zeugen die vielen Menschenknochen, die ich in diesen Schuttschichten fand, und vor allen Dingen die in den Tiefen des Minervatempels gefundenen Gerippe mit Helmen; denn, wie wir aus Homer wissen, wurden alle Leichname verbrannt und die Asche in Urnen beigesetzt, deren ich eine gewaltige Menge in allen vorgriechischen Schuttschichten dieses Berges fand. Ferner lässt keinen Zweifel über die Zerstörung der Stadt durch Feindes Hand der von mir auf der großen Ringmauer neben dem königlichen Palast, in 8½ Meter Tiefe und mit 1½ bis 2 Meter rotem trojanischen Schutt und einer posttrojanischen, 6 Meter hohen Festungsmauer bedeckt gefundene Schatz, den wahrscheinlich jemand von der königlichen Familie während der Zerstörung versucht hat zu retten, aber gezwungen worden ist, auf der Ringmauer zurückzulassen.
Auf die Angaben der Ilias vertrauend, an deren Genauigkeit ich wie ans Evangelium glaubte, meinte ich Hissarlik, der Berg den ich seit drei Jahren durchwühlt habe, sei die Pergamos der Stadt, Troja müsse wenigstens 50.000 Einwohner gehabt und seine Baustelle müsse sich bis über die ganze Baustelle des llium der griechischen Kolonie hinaus ausgedehnt haben, dessen Plan im Maßstab von 2787⁄10000 Millimeter pro Meter ich auf Tafel 213 gebe. Dessen ungeachtet wollte ich die Sache genau untersuchen und glaubte dies nicht besser tun zu können, als durch Anlegung von Brunnen. Behutsam fing ich daher an, an den äußersten Enden des griechischen Ilium Brunnen zu graben, die aber bis zum Urboden nur Hauswände oder Mauern, sowie Bruchstücke von Töpferware aus griechischer Zeit, und keine Spur von den Trümmern der vorhergehenden Völker zum Vorschein brachten. Ich rückte daher dieser vermeintlichen Pergamos mit dem Graben von Brunnen allmählich näher, ohne besseren Erfolg, und da nun endlich gar sieben Brunnen, die ich unmittelbar am Fuß dieses Berges bis zum Felsen grub, nur griechisches Mauerwerk und nur griechische Topfscherben zum Vorschein brachten, so trete ich jetzt aufs entschiedenste mit der Behauptung hervor: dass sich Troja auf die kleine Fläche dieses Berges beschränkt hat, dass seine Baustelle genau angegeben ist durch seine von mir auf vielen Stellen bloßgelegte große Ringmauer; dass die Stadt keine Akropolis hatte und die Pergamos eine reine Erfindung Homers ist; ferner dass Trojas Baustelle in posttrojanischer Zeit bis zur griechischen Ansiedlung nur um so viel zugenommen hat, wie der Berg durch den hinunter geworfenen Schutt gewachsen ist, dass aber dem Ilium der griechischen Kolonie sogleich bei dessen Gründung eine große Ausdehnung gegeben wurde.
Wenn man sich aber einerseits hinsichtlich der Größe Trojas getäuscht sieht, so muss man doch andererseits eine große Genugtuung in der nunmehr erlangten Gewissheit empfinden, dass es wirklich ein Troja gab, dass dies Troja dem größten Teil nach von mir ans Licht gebracht ist, und dass die Ilias – wenn auch in übertriebenem Maßstab – diese Stadt und die Tatsache ihres tragischen Endes besingt. Homer ist aber nun einmal kein Historiker, sondern ein epischer Dichter, und muss man ihm die Übertreibungen zugute halten.
Da Homer die Topographie und die Witterungsverhältnisse der Troade so genau kennt, so leidet es wohl keinen Zweifel, dass er selbst Troja besucht hat; da er aber lange nach dessen Untergang kam und die Baustelle Trojas sogleich bei der Katastrophe durch die Trümmer der zerstörten Stadt tief im Schutt begraben und seit Jahrhunderten durch eine neue Stadt überbaut worden war, so konnte er weder Iliums großen Turm, noch das Skaeische Thor, noch die große Ringmauer, noch den Palast des Priamos sehen, denn, wie jeder Besucher der Troade sich in meinen Ausgrabungen überzeugen kann, lastete auf allen diesen Denkmälern unsterblichen Ruhms, schon allein von Trojas Trümmern und roter Asche, eine Decke von 1½ bis 3 Meter oder 5 bis 10 Fuß Dicke, und diese Schuttaufhäufung muss bis Homers Besuch noch sehr bedeutend zugenommen haben. Homer stellte keine Ausgrabungen an, um jene Denkmäler ans Licht zu bringen; er kannte sie aber aus der Überlieferung, denn seit Jahrhunderten war Trojas tragisches Ende im Munde aller Sänger, und das Interesse, was sich daran knüpfte, war so groß, dass, wie meine Ausgrabungen erwiesen haben, die Tradition selbst in vielen Einzelheiten genau die Wahrheit berichtete; so z. B. das Vorhandensein des Skaeischen Tors in Iliums großem Turm; der stete Gebrauch des Skaeischen Tors im Plural, weil dasselbe als doppelt geschildert worden sein muss, und in der Tat hat es sich als doppelt herausgestellt. Nach den Versen der Ilias, XX, 307—308 scheint es mir jetzt höchst wahrscheinlich, dass der König von Troja zur Zeit von Homers Besuch sein Geschlecht in gerader Linie von Aeneas abzustammen vorgab.
Weil nun Homer Iliums großen Turm und das Skaeische Tor nicht sah, sich nicht denken konnte, dass diese Bauten tief unter seinen Füssen begraben ruhten, sich auch wohl – nach den damals bestehenden Gesängen – Troja als sehr groß vorstellen mochte und es vielleicht noch größer zu schildern wünschte, so ist es nicht zu verwundern, wenn er Hektor vom Palast in der Pergamos heruntersteigen und die Stadt durcheilen lässt, um ans Skaeische Tor zu gelangen, während dieses in der Wirklichkeit, ebenso wie Iliums großer Turm, in welchem es sich befindet, unmittelbar vor dem königlichen Haus ist. Dass dies Haus wirklich des Königs Haus ist, das scheint durch seine Grösse, durch die Dicke seiner steinernen Mauern, im Gegensatz zu den übrigen fast ausschliesslich von ungebrannten Ziegeln erbauten Häusern der Stadt, durch seine imposante Lage auf einem künstlichen Hügel unmittelbar vor oder neben dem Skaeischen Tor, dem großen Turm und der großen Ringmauer, ferner durch die darin gefundenen vielen herrlichen Sachen, namentlich durch die ungeheure, königlich geschmückte Vase mit dem Bild der eulenköpfigen ilischen Schutzgöttin Minerva, weiter, und vor allen Dingen, durch den unmittelbar neben demselben gefundenen reichen Schatz hervorzugehen. Ich kann natürlich nicht beweisen, dass der Name des Königs, des Besitzers des Schatzes, wirklich Priamus war, ich nenne ihn aber so, weil er mit diesem Namen von Homer und von der ganzen Tradition genannt wurde. Alles was ich beweisen kann, ist, dass der Palast dieses Besitzers des Schatzes, dieses letzten trojanischen Königs, gleichzeitig mit dem Skaeischen Tor, der großen Ringmauer und dem großen Turm in der großen Katastrophe untergegangen ist, welche die ganze Stadt verheerte. Ich beweise durch jene 1½ und 3 Meter hohen roten und gelben kalzinierten trojanischen Trümmermassen, womit alle diese Bauten bedeckt wurden und eingehüllt blieben, und durch die vielen posttrojanischen Bauten, die wiederum auf diesen kalzinierten Trümmermassen errichtet wurden, dass weder der Palast des Schatzinhabers noch das Skaeische Tor, noch die große Ringmauer, noch Iliums großer Turm jemals wieder ans Tageslicht gekommen sind. Eine Stadt, deren König einen solchen Schatz besaß, war für damalige Verhältnisse unermesslich reich, und weil Troja reich war, so war es mächtig, hatte viele Untertanen und erhielt Hilfstruppen von allen Seiten.
Ich schrieb im vorigen Jahr den Bau von Iliums großem Turm den ersten Ansiedlern dieses Berges zu, bin jedoch längst zur festen Überzeugung gekommen, dass er vom zweiten Volk, den Trojanern, herrührt, da er auf der Nordseite nur innerhalb der trojanischen Trümmerschichten und 5 bis 6 Meter oberhalb des Urbodens wirkliches Mauerwerk hat. Ich habe in meinen Briefen wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass die von mir auf dem Turm gefundenen Terrakotten nur jenen aus 11 bis 14 Meter Tiefe zur Seite gestellt werden können. Dies gilt aber nur für die Schönheit des Tons und die Eleganz der Gefäße, keineswegs aber für die Typen derselben, die – wie man sich im Atlas dieses Werks überzeugen kann – durchaus verschieden sind von denen der Tongefäße der ersten Ansiedler.
Man glaubte bisher, das Vorfinden von steinernen Werkzeugen bezeichne die Steinperiode; meine Ausgrabungen hier in Troja stellen jedoch diese Meinung als durchaus irrig heraus; denn sehr häufig finde ich schon gleich unterhalb der Trümmerschichten der griechischen Kolonie, d. h. schon in 2 Meter Tiefe, steinerne Werkzeuge, die von 4 Meter Tiefe abwärts in sehr großen Massen vorkommen, jedoch in den trojanischen Trümmerschichten, in 7 bis 10 Meter unterhalb der Oberfläche, im allgemeinen viel besser gearbeitet sind. Ich mache ganz besonders darauf aufmerksam, dass ich leider bei Anfertigung des vorstehenden Werks in den mir jetzt unbegreiflichen Irrtum verfallen bin, jene herrlich geschliffenen Waffen und Werkzeuge, die meistenteils aus Diorit, aber oft auch aus sehr hartem durchsichtigen grünen Stein sind, die in dieser und anderen Abbildungen dargestellt sind, Keile zu nennen. Wie sich jeder überzeugen kann, sind es aber keine Keile, sondern Beile oder Äxte, und die meisten derselben werden als Streitäxte gebraucht worden sein; ja viele scheinen, nach ihrer Form zu urteilen, sich ausgezeichnet als Lanzen zu eignen und mögen als solche benutzt worden sein. Ich habe viele Hunderte davon gesammelt. Gleichzeitig aber mit den Tausenden von steinernen Werkzeugen finde ich auch viele kupferne, und beweisen die viel vorkommenden Formsteine aus Glimmerschiefer zum Gießen von kupfernen Waffen und Werkzeugen, sowie die vielen kleinen Schmelztiegel und roh gemachten kleinen Näpfe, Löffel und Trichter zum Füllen der Formen, dass dies Metall viel gebraucht wurde, worüber außerdem die erwähnte Schicht von Kupfer- und Bleischlacken in 8½ bis 9 Meter Tiefe keinen Zweifel lässt. Zu bemerken ist, dass alle vorkommenden kupfernen Gegenstände aus reinem Kupfer sind, ohne jegliche Beimischung eines anderen Metalls. Ja, der Schatz des Königs enthielt davon einen Schild mit großem Nabel, eine große Kasserolle, einen Kessel oder Vase, eine lange Platte mit in der Feuersbrunst darauf geschmolzener silberner Vase, viele Bruchstücke anderer Vasen, wovon eine mit zwei Röhren an jeder Seite zum Aufhängen mit Schnüren; eine andere mit krummen, sehr künstlichen Griffen an den Seiten und einer wahrscheinlich am oberen Teil befestigt gewesenen krummen Röhre sehr niedlicher Form, dreizehn Lanzen, vierzehn jener hier häufig vorkommenden, anderswo aber noch niemals gefundenen Waffen, die nach einem Ende spitz aber stumpf, nach dem andern in eine breite Schneide auslaufen; ich hielt sie früher für Lanzen, bin aber jetzt zur Überzeugung gekommen, dass sie nur als Streitäxte gebraucht sein können, obwohl sie kein Loch in der Mitte haben. Ich fand dort weiter sieben große zweischneidige Dolchmesser, ein gewöhnliches Messer sowie einen großen Schlüssel, der wahrscheinlich zu der hölzernen Kiste gehört hat, in welcher man versucht hat, den Schatz zu retten. Da alle Gegenstände des Schatzes dicht zusammengepackt waren und einen viereckigen Raum einnahmen, so kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass sie in einer hölzernen Kiste enthalten waren.
Außer dem bereits vorhin erwähnten großen goldenen Becher, welcher gegossen ist und dessen beide gewaltigen, hohlen Griffe darangeschmiedet sind, fand ich im Schatz eine 403 Gramm wiegende kugelrunde goldene Flasche, einen 226 Gramm wiegenden einfachen goldenen Becher; einen kleinen Becher von 70 Gramm, der nicht aus reinem Golde ist, und sind die drei letzteren Gegenstände mit dem Hammer getrieben (δφυρήλατα); ferner 60 herrliche goldene Ohrringe, worunter vier beinahe in Korbform, mit prachtvollen, von fünf oder sechs Kettchen mit Idolen der eulenköpfigen Schutzgöttin gebildeten Gehängen, und sechs goldene Armbänder, wovon drei geschlossen sind und zu beweisen scheinen, dass die Hände der Trojanerinnen viel kleiner gewesen sein müssen als die jetzigen Frauenhände, denn ein jetziges Mädchen von 10 Jahren würde Mühe haben, ihre Hand durchzustecken; auch die Öffnung der drei nicht geschlossenen Armbänder, welche doppelt sind, beweist, dass sie von Frauen mit ungemein kleinen Händen getragen sind. Weiter fand ich im Schatz ein goldenes Stirnband (ἄμπυξ) und zwei wundervolle goldene Diademe (χρήδεμνα), wovon das eine sechzehn herunterhängende Kettchen mit Idolen der ilischen Schutzgöttin und 74 andere mit Baumblättern verzierte Kettchen hat; das zweite Diadem hat 61 herunterhängende Kettchen mit Idolen derselben Göttin. Ich fand weiter im Schatz nicht weniger als 8750 kleine, kunstvoll gearbeitete durchbohrte Gegenstände aus Gold, wie Zylinder, ausgezackte Scheibchen, Kugeln, Prismen, Würfel, mit einer Röhre zum Aufziehen versehene Baumblätter, einfache, doppelte oder dreifache Ringe mit durchgehendem Loch an zwei Seiten, Stücke ganz in Form kleiner Glockenzungen, Knöpfe mit einer Öse, sowie Doppelknöpfe, die aber nicht wie unsere Hemdknöpfe, zusammengeschmiedet, sondern einfach zusammengesteckt sind, denn aus der Höhlung des einen kleinen Knopfes steht eine kleine Röhre (αύλίδχος), aus der des andern eine Stange (ἔμβολον) hervor, und steckt man letztere in die erstere, um den Doppelknopf herzustellen. Auf mehr als einem Drittel dieser kleinen Gegenstände sieht man eingeschnittene Verzierungen von acht oder sechzehn Rillen, die oft so fein gemacht sind, dass man nur mittels einer Lupe im Stande ist, sie zu unterscheiden und ihre große Symmetrie zu bewundern. Diese 8750 kleinen goldenen Gegenstände dienten wahrscheinlich teils an Halsschnüren, teils an Schmucksachen auf Leder. Der Schatz enthielt ferner sechs an einem Ende abgerundete an dem anderen in Form des Halbmondes ausgeschnittene Klingen aus allerreinstem Silber, deren Gewicht leider neben den Abbildungen Tafel 200 nicht genau angegeben ist; sie wiegen 171, 173, 174, 183 und 190 Gramm; nur zwei der Stücke haben genau dasselbe Gewicht von 174 Gramm; ferner einen silbernen Becher und drei große silberne Vasen; auf einer derselben ist viel Kupfer, auf einer andern das Bruchstück einer kleineren silbernen Vase in der Feuersbrunst festgeschmolzen. Der Schatz enthielt ferner zwei kleinere äusserst kunstvoll gearbeitete silberne Vasen mit Deckeln, in Form von langen phrygischen Hüten, und hat die eine an jeder Seite ein, die andere an jeder Seite zwei Röhrchen für die Schnüre zum Aufhängen. Es gehört höchst wahrscheinlich auch noch zum Schatz eine acht Tage vor dessen Entdeckung daneben gefundene große silberne Vase, in welcher ich einen großen herrlichen Becher fand, der, wie sich jetzt herausgestellt hat, aus Elektron ist und nicht aus Silber, wie ich irrtümlich im vorletzten Aufsatz dieses Buchs berichtet habe. Auch vier silberne Schalen (φιάλαι) enthielt der Schatz, denn die eine derselben fand ich mit den anderen Gegenständen zusammen, die drei übrigen einige Tage später am Abhang der großen Ringmauer, etwa 1 Meter unterhalb des Schatzes. Der durch seine vielen wichtigen Entdeckungen und Schriften berühmte Professor der Chemie Landerer in Athen, welcher auch alle silbernen Sachen des Schatzes genau untersucht hat, findet die beiden kleinen Vasen aus ganz reinem Silber, während die vier großen Vasen, der kleine Becher und die vier Schalen 95 Prozent Silber und 5 Prozent Kupfer enthalten, welches, wie er sagt, beigemischt ist, um dem Silber größere Härte zu geben und es mit dem Hammer treiben zu können.
Dieser in großer Tiefe, in den Ruinen der für mythisch angesehenen Stadt Troja von mir entdeckte große Schatz des für mythisch gehaltenen Königs Priamos aus dem mythischen heroischen Zeitalter, ist jedenfalls eine in der Archäologie einzig dastehende Entdeckung großen Reichtums, großer Zivilisation und großen Kunstsinns in einer der Erfindung der Bronze vorhergehenden Zeit, in einer Zeit, wo man Waffen und Werkzeuge aus reinem Kupfer gleichzeitig mit gewaltigen Massen steinerner Waffen und Werkzeuge anwandte. Dieser Schatz lässt auch keinen Zweifel, dass Homer wirklich dergleichen goldene und silberne Sachen gesehen haben muss, wie er fortwährend beschreibt; in jeder Beziehung ist er von unermesslicherem Wert für die Wissenschaft und wird jahrhundertelang der Gegenstand eingehender Forschungen bleiben.
Leider finde ich auf keinem der Gegenstände des Schatzes eine Inschrift, auch kein anderes religiöses Symbol als die an den beiden Diademen (χρήδεμνα) und an den vier Ohrgehängen prangenden 100 Idole der homerischen „θεὰ γλανχῶπις Άδήνη“, welche uns aber den unumstößlichen Beweis geben: dass der Schatz der Stadt und dem Zeitalter angehören, welche Homer besingt.
Indessen fehlte die Schriftsprache zu jener Zeit nicht, und fand ich z. B. in 8 Meter Tiefe, im königlichen Palast, die oben abgebildete Vase mit einer Inschrift, und mache ich ganz besonders darauf aufmerksam, dass von den in derselben vorkommenden Schriftzügen der dem griechischen Ρ ähnliche Buchstabe auch schon in der Inschrift auf dem aus 7 Meter Tiefe stammenden Petschaft, Bild unten, der zweite und dritte Buchstabe, links von diesem, auf dem ebenfalls aus 7 Meter Tiefe stammenden, kleinen Vulkan aus Terrakotta (siehe Kapitel 11, Bild No. 145 und 146), auch der dritte Buchstabe auf den aus 3 Meter Tiefe stammenden beiden kleinen Trichtern aus Terrakotta, vorkommt.
Ich fand ferner im königlichen Palast die auf Tafel 190, No. 3474 abgebildete ausgezeichnet eingravierte Inschrift, finde hier aber nur ein Schriftzeichen, welches einem Buchstaben der Inschrift des erwähnten Petschafts ähnlich ist. Mein geehrter Freund, der große Indiologe Herr Emile Burnouf, vermutet, dass alle diese Schriftzeichen einem sehr alten gräco-asiatischen Lokalalphabet angehören. Professor H. Brunn in München schreibt mir, dass er diese Inschriften dem Professor Haug gezeigt und dieser auf Verwandtschaft und Zusammenhang mit dem Phönizischen hingewiesen habe (von dem allerdings das griechische Alphabet abhängig ist), und ferner auf gewisse Analogien mit der Inschrift der Erztafel, die zu Idalion auf Zypern gefunden und jetzt im Kabinet des médailles zu Paris ist.
Professor Brunn fügt hinzu, dass Beziehungen der trojanischen Funde zu Zypern in keiner Weise auffallen, sondern sich vielmehr sehr wohl mit Homer vertragen würden; dass jedenfalls auf diese Beziehungen ein Hauptaugenmerk zu richten ist, da nach seiner Meinung Zypern die Wiege der griechischen Kunst, oder sozusagen der Kessel ist, in dem asiatische, ägyptische, griechische Ingredienzen zusammengebraut wurden, aus denen sich später die griechische Kunst abklärte.
Herrliche Töpferware, und besonders große und kleine Becher mit zwei Henkeln oder mit einem Griff von unten in Form einer Krone, Vasen mit Röhren an den Seiten und in gleicher Richtung mit Löchern im Mund zum Aufhängen mit Schnüren, ferner alle anderen Arten von Hausgerät finde ich in diesen trojanischen Trümmerschichten in großer Häufigkeit, auch eine schön verzierte knöcherne Flöte, mehrere Teile von anderen Flöten und das herrlich verzierte elfenbeinerne Stück einer Leier mit nur vier Saiten.
Ebenso wie die ersten Siedler dieser heiligen Stätte waren auch die Trojaner Indogermanen, denn ich finde bei ihnen in gewaltigen Massen die mit eingeschnittenen religiösen Symbolen bedeckten kleinen Stücke Terrakotta in Gestalt des Vulkans und des Karussells.
Das Baumaterial der Trojaner ist verschiedener Art; mit seltener Ausnahme bestehen alle von mir ans Licht gebrachten Hauswände nur aus ungebrannten, an der Sonne getrockneten Ziegeln, von denen durch die Glut der Feuersbrunst eine Art von wirklich gebrannten Ziegeln geworden ist; der königliche Palast aber, sowie zwei kleine Bauten in den Tiefen des Minervatempels, Iliums großer Turm, das Skaeische Tor und die große Ringmauer bestehen dagegen aus mit Erde vereinigten, meistens unbehauenen Steinen, deren weniger raue Seite nach außen gekehrt ist, so dass die Wände ein ziemlich glattes Aussehen haben.
Ich glaubte im vorigen Jahr, bei Aufdeckung von Iliums großem Turm, dass derselbe einst höher gewesen sein müsse als er jetzt ist, nämlich 6 Meter oder 20 Fuss; seine glatt gemauerte Fläche neben dem Skaeischen Tor, sowie die weiterhin auf demselben befindlichen Bänke, nicht Ruinen, wie ich früher glaubte, beweisen aber, dass er nie höher gewesen sein kann. Ganz besonders mache ich darauf aufmerksam, dass das Mauerwerk des Skaeischen Tors bei dessen Aufdeckung noch so merkwürdig neu aussah, als ob es erst ganz kürzlich errichtet worden wäre. Bestimmt hat es mächtige hölzerne Verteidigungswerke, und wahrscheinlich auch einen hölzernen Turm oberhalb der Torflügel gehabt, denn sonst ist es mir unerklärlich, wie der Eingang zum Tor 10 Fuß hoch mit jener roten trojanischen Holzasche verschüttet, und namentlich wie dort, von anderen Bauten entfernt, die Glut so groß hat sein können, dass selbst die dicken Steinplatten davon zerstört worden sind.
Homer (Ilias, V, 638–642) spricht von einer dem trojanischen Krieg vorhergegangenen Zerstörung Trojas durch Herkules, und wird es uns ewig ein Rätsel bleiben, ob sich diese durch die Überlieferung bis zu seiner Zeit erhaltene Kunde wirklich auf das Ilium des Priamos oder auf die demselben vorausgegangene uralte Stadt der ersten Ansiedelung bezieht.
Für die Chronologie Trojas haben wir nur die allgemeine Annahme des Altertums, dass der trojanische Krieg ungefähr 1200 Jahre v. Chr. stattgefunden hat, und die Angabe Homers (Ilias, XX, 215–237), dass der erste trojanische König, Dardanos, Dardania gründete, welche Stadt ich mit Virgil und Euripides mit Ilium für synonym halte, und dass sie nach ihm von seinem Sohn Erichthonios, dann von seinem Enkel Tros, von seinem Urenkel Ilos, sowie von dessen Sohn Laomedon und Enkel Priamos beherrscht wurde. Wenn wir jedem dieser sechs Könige auch eine lange Regierung von 33 Jahren zugestehen, so bringen wir doch die Gründung der Stadt nur kaum auf 1400 Jahre v. Chr., also nur auf 700 Jahre vor der griechischen Kolonie.
Die Baustelle Trojas, welche zur Zeit der Gründung der Stadt 10 Meter unterhalb der jetzigen Oberfläche war, war nach der Zerstörung nur 7 Meter unterhalb derselben, als Ilium von einem andern Volk indogermanischen Stammes wieder aufgebaut wurde; ich finde nämlich in den Trümmerschichten dieses Volks, die von 7 bis 4 Meter unter der jetzigen Oberfläche reichen, die nämlichen Stücke Terrakotta mit religiösen Symbolen.
Da ich bei jedem Gegenstand in den photographischen Tafeln des Atlas genau die Tiefe vermerkt habe, in welcher er gefunden worden ist, so kann man leicht die von diesem Volk stammenden Sachen herausfinden. Die Töpferwaren dieser Nation haben Ähnlichkeit mit denen der Trojaner, sind aber schlechter und gröber, und es kommen viele neue Typen vor; fast alle Vasen haben auch hier eine Röhre an jeder Seite zum Aufhängen mit Schnüren. Ich fand hier, in 5 Meter Tiefe, das steinerne Stück einer Leier mit sechs Saiten, und in 4 Meter Tiefe das schön verzierte elfenbeinerne Stück einer anderen von sieben Saiten. Man findet beide Stücke in den fotografierten Tafeln des Atlas dargestellt.
Die Architektur dieses Volks war, wie man aus den vielen von mir aufgedeckten Hauswänden ersieht, durchgehende von kleinen mit Erde vereinigten Steinen; jedoch sieht man auch auf zwei Stellen in den Tiefen des Minervatempels eine Mauer von an der Sonne getrockneten Ziegeln, die dieser Nation anzugehören scheinen. Die Häuser derselben waren kleiner, und in denselben war weniger Holz verwandt, als in denen der Trojaner, denn obwohl die aufeinanderruhenden Hausreste mehrfache große Konvulsionen beurkunden, so findet man hier doch viel weniger verkohlte Trümmer als beim vorhergehenden Volk; ja diese Schuttschichten haben meistenteils ein graues oder schwarzes Aussehen, und sieht man in denselben Millionen kleiner Muschelschalen, Knochen, Fischgräten u. s. w. Merkwürdig ist es, dass sich in diesen Trümmerschichten gewisse Typen von Terrakottas nur genau in derselben Tiefe finden, und dass so z. B. die herrlichen schwarzen Becher in Form von Sanduhren und mit zwei großen Henkeln nur auf 6 Meter Tiefe beschränkt sind.
In den beiden ersten Jahren meiner Ausgrabungen fand ich in 4 bis 7 Meter Tiefe fast gar kein Kupfer und glaubte schon, Metall sei bei diesem Volk selten oder gar nicht bekannt gewesen. In diesem Jahr jedoch fand ich auch in diesen Trümmerschichten viele kupferne Nägel, auch einige Messer und Streitäxte und Formsteine aus Glimmerschiefer zum Gießen derselben und anderer Waffen und Werkzeuge. Immerhin muss Kupfer bei dieser Nation selten gewesen sein, denn steinerne Werkzeuge, wie Messer aus Silex, Hämmer und Beile aus Diorit u. s. w., kommen zu Tausenden vor.
Dem Anschein nach verschwand auch dieses Volk gleichzeitig mit der Zerstörung der Stadt, denn nicht nur finde ich von 4 Meter Tiefe aufwärts bis 2 Meter Tiefe viele neue Typen von Terrakotta-Gefäßen, sondern ich finde auch keine Reste von Hauswänden mehr; ja selbst die einzelnen Steine fehlen fast gänzlich. Jedenfalls wurde die Stadt sogleich nach der Zerstörung aus Holz wieder aufgebaut von einem verwandten Volk, denn die kleinen, mit entsprechenden religiösen Symbolen geschmückten Terrakottas, obwohl häufig mit neuen Typen, kommen auch in diesen Schuttschichten vielfältig vor. Es kommen zwar auch in diesen Tiefen Festungsmauern vor, aber diese waren schon von dem vorhergehenden Volk gebaut, wie z. B. die in 7 Meter Tiefe und 1½ bis 2 Meter oberhalb des Schatzes gegründete 6 Meter hohe Mauer, welche bis 1 Meter unter der Oberfläche reicht. Das hölzerne Ilium war dem Anschein nach noch weniger glücklich als die steinerne Stadt seiner Vorgänger, denn wie es die zahlreichen kalzinierten Trümmerschichten beweisen, wurde es vielfältig durch Feuer verheert. Ob diese Feuersbrünste zufällig ausbrachen oder durch Feindes Hand angelegt wurden, das muss uns ewig ein Rätsel bleiben; soviel ist aber gewiss und aus den aus diesen Tiefen stammenden Terrakottas ersichtlich, dass die von Anfang an geringe Zivilisation des Volks bei den fortwährenden Verheerungen seiner Stadt immer mehr verkrüppelte. Ich finde bei dieser Nation Lanzen, Streitäxte sowie Werkzeuge aus reinem Kupfer und Formsteine zum Gießen derselben; auch eine Menge kupferner Nägel, die aber – gleich wie bei allen vorhergehenden Völkern, die diesen Berg bewohnt haben – zu lang und dünn sind, um zum Festschlagen in Holz verwandt worden zu sein, und jedenfalls als Brustnadeln gebraucht sein müssen; dass dem so ist, scheinen auch zwei solcher kupferner Nägel zu beweisen, an deren oberem Teil ich Reihen von durchbohrten Perlen aus Gold oder Elektron festgeschmiedet fand. Diese beiden kupfernen Nägel wurden zwar unmittelbar unter der Oberfläche gefunden, müssen aber jedenfalls der vorgriechischen Zeit angehören.
Steinerne Werkzeuge, wie z. B. Hämmer und herrlich geschliffene Beile und Streitäxte aus Diorit, kommen auch bei diesem Volk in 4 bis 2 Meter Tiefe vor, aber bedeutend weniger als bei dem vorhergehenden.
Als die Oberfläche des Bergs um 2 Meter niedriger war als sie jetzt ist, wurde Ilium von einer griechischen Kolonie aufgebaut, und haben wir bereits versucht, nachzuweisen, dass diese Niederlassung ungefähr um 700 v. Chr. erfolgt sein muss. Von nun an findet man Reste hellenischer Hauswände aus ohne Zement zusammengelegten großen behauenen Steinen; von ungefähr 1 Meter unter der Oberfläche aufwärts auch Trümmer von Bauten, deren Steine mit Zement oder Kalk verbunden sind. Kupferne Medaillen Iliums aus der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Constans II. und Konstantin II. sowie ältere ilische Münzen mit dem Bild der Minerva und Medaillen von Alexandria Troas kommen in großer Menge vor, auch einige Münzen von Tenedos, Ophrynium und Sigeion, einzeln bis 1 Meter, aber größtenteils in weniger als 50 Zentimeter unter der Oberfläche. Ich habe einmal irrtümlich bemerkt, dass hier auch byzantinische Münzen nah an der Oberfläche vorkommen. Aus späterer Zeit als Constans II. und Konstantin II. habe ich hier aber in meinen dreijährigen Ausgrabungen nicht eine einzige Medaille gefunden, ausser zwei schlechten Münzen eines byzantinischen Klosters, die von Schäfern verloren sein mögen; und da hier jede Spur von byzantinischem Mauerwerk oder byzantinischer Töpferware durchaus fehlt, so ist als bestimmt anzunehmen, dass das Ilium der griechischen Kolonie gegen Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. untergegangen und nie wieder ein Dorf, geschweige denn eine Stadt auf seiner Baustelle errichtet worden ist. Die in meinem Aufsatz vom 1. März 1873 von mir erwähnte, aus mit Zement vereinigten korinthischen Säulen bestehende Mauer, die ich aus dem Mittelalter zu stammen glaubte, muss jedenfalls aus der Zeit Konstantins I. oder Constans’ II. stammen, als der Minervatempel durch den frommen Eifer der ersten Christen zerstört wurde.
Von den Mauern und Festungswerken dieser griechischen Kolonie sind hauptsächlich nur die anscheinlich von Lysimachos erbauten erhalten geblieben, und sieht man von denselben auf Tafel 109, gleich links, eine Bastion, sowie auf Tafel 112 eine Mauer. Aus älterer Zeit, und wahrscheinlich vom Anfang der griechischen Kolonie, stammt der untere, hervorstehende Teil der Turmmauer, die man auf Tafel 212 in dem Einschnitt auf jener Seite des Skaeischen Tors sieht. große politische Konvulsionen oder Katastrophen scheinen fortan wenig oder gar nicht mehr vorgekommen zu sein, denn die Schuttaufhäufung beträgt während der langen Dauer der griechischen Kolonie, sage während 10½ Jahrhunderten, nur 2 Meter.
Merkwürdigerweise finde ich in diesen griechischen Trümmerschichten äußerst wenig Metall; ein halbes Dutzend sichelförmiger Messer, eine zweischneidige Axt, ein paar Dutzend Nägel, ein Becher, ein paar Lanzen und Pfeile u. s. w. sind so ziemlich alles was ich fand; ich beschrieb diese Gegenstände in meinen Aufsätzen und im Katalog als aus Kupfer; wie sich aber bei näherer Untersuchung herausgestellt hat, sind sie aus Bronze, und kommt reines Kupfer in der griechischen Kolonie nicht mehr vor. Aus Eisen fand ich nur ganz nah an der Oberfläche einen Schlüssel merkwürdiger Form und ein paar Pfeile und Nägel. Wie wir aus Homer wissen, hatten auch die Trojaner Eisen, ja sogar das von ihm χύαονς genannte Metall, welches man schon im Altertum durch χάλυψ (Stahl) übersetzte. Ich beteuere aber, weder bei den Trojanern, noch bei irgendeinem der andern der griechischen Kolonie vorangegangenen Völker, die diesen Berg bewohnt haben, auch nur eine Spur von diesen Metallen gefunden zu haben. Es mögen aber immerhin eiserne und stählerne Gerätschaften dagewesen sein; ja ich glaube ganz bestimmt, dass sie dagewesen sind, sie sind aber spurlos verloren gegangen; denn bekanntlich zersetzt sich Eisen und Stahl viel leichter als Kupfer. Von Zinn, dessen Homer so vielfältig erwähnt, fand ich natürlich keine Spur, denn dies Metall zersetzt sich bekanntlich mit großer Schnelligkeit, selbst wenn es an einem trocknen Ort liegt. Blei kam bei allen Völkern vor, die diesen Berg bewohnt haben, bei den Völkern vor der griechischen Ansiedlung aber hauptsächlich nur in Klumpen, in Form von Halbkugeln. Nur erst in der griechischen Kolonie finde ich es in allgemeinem Gebrauch, und sogar als Verbindungsmittel von Bausteinen angewandt. Nach der Größe der Baustelle des Iliums der griechischen Kolonie zu urteilen, mag dasselbe 100.000 Einwohner gehabt haben und muss in seiner Blütezeit sehr reich gewesen sein, und die plastische Kunst muss hier einen hohen Grad von Vollkommenheit erreicht haben. Die mit den Trümmerhaufen großartiger Bauten bedeckte Baustelle ist nämlich mit Bruchstücken von ausgezeichneten Skulpturen übersät, und der hier in den Tiefen des Apollotempels von mir entdeckte und jetzt meinen Garten in Athen zierende 2 Meter lange, 86 Zentimeter hohe herrliche Triglyphenblock mit einer Metope, welche den Phöbus Apollo mit den vier Rossen der Sonne darstellt, ist eins der erhabensten Meisterwerke, welche uns aus der Blütezeit der griechischen Kunst erhalten sind.
In der Beschreibung, welche ich sogleich nach der Entdeckung dieses Kunstschatzes in meinem Aufsatz vom 18. Juni 1872 machte, bemerkte ich, dass dies Kunstwerk aus der Zeit des Lysimachos, sage ungefähr vom Jahr 306 ν. Chr. stammen müsse. Ich schickte einen Gipsabguss davon an das Museum für Gipsabgüsse in München, und schreibt mir der Vorsteher desselben, Professor H. Brunn, welcher jedenfalls eine der größten Autoritäten der Welt für die plastischen Kunstwerke des Altertums ist, wie folgt darüber: „Selbst Fotografien reichen doch zur Beurteilung plastischer Werke nie ganz aus, und hat mir auch hier erst der Abguss die volle Gewissheit gegeben, dass dieses Werk weit günstiger beurteilt werden muss, als es in der archäologischen Zeitung geschehen ist. Ich wage nicht, über die Triglyphen bestimmt abzusprechen: die Geschichte des dorischen Stils nach der Zeit des Parthenon und der Propyläen liegt noch durchaus im argen, doch lässt sich der gerade Abschnitt der Cannele gewiss in vorrömischer Zeit nachweisen. Von äusseren Kriterien bleibt so zunächst der Strahlenkranz. Nach den Untersuchungen von Stephani (Nimbus und Strahlenkranz) kommt derselbe erst etwa in der Zeit Alexanders des großen vor. Für die spezielle Form, lange und kurze Strahlen, haben wir die von Curtius angeführten Münzen Alexanders I. von Epirus und von Keos, resp. Karthaea. Das jüngste Beispiel, welches ich bis jetzt gefunden, bietet die Unterweltsvase von Canosa im hiesigen Museum, die spätestens in das 2. Jahrhundert v. Chr. gehört; so wären also für das Relief die äußersten Termini etwa Ende des 4. und Mitte des 2. Jahrhunderts. Künstlerisch zeigt die Komposition die größten Feinheiten in der Lösung eines schwierigen Problems. Das Viergespann soll sich nämlich nicht in der Relieffläche bewegen, sondern so erscheinen, als ob es in halber Wendung aus derselben herauskomme. Das ist besonders dadurch erreicht, dass der rechte Hinterschenkel des Pferdes im Vordergrund stark zurückgedrängt ist, während der linke Fuß vorschreitet, dass außerdem dieses Pferd in leiser Verkürzung gebildet ist, dass die Fläche jenes Schenkels tiefer liegt als die obere Fläche der Triglyphen, die Fläche des Vorderbuges und des Halses dagegen etwas höher, während der Kopf, um das Gesetz des griechischen Reliefstils zu wahren, wieder mit der Grundfläche ziemlich parallel steht. Darum fehlt auch jede Andeutung eines Wagens, der durch das vordere Pferd verdeckt zu denken ist. Dann ist auch die Stellung des Gottes, dem Kopf einigermaßen folgend, halb nach vorne gewendet, und nur um auch hier die Stellung mit dem Reliefgesetz in Konflikt zu bringen, ist der Arm wieder stark nach innen gewendet. Wenn man sodann in dem Übergreifen des Kopfes auf die obere Leiste des Triglyphs eine Inkorrektheit hat sehen wollen, so finde ich darin einen besonders glücklichen Gedanken, der wohl an die freilich wieder verschiedene Auffassung am Parthenongiebel erinnern darf, wo Helios nur erst mit Kopf und Schultern aus dem Wagen des Ozeans auftaucht. Hier bricht Helios sozusagen aus den Pforten des Tags hervor und überstrahlt mit seinem Glanz das All. Das sind Feinheiten, wie sie nur der griechischen Kunst in ihrer vollen Kraft eigen sind. Die Ausführung entspricht durchaus dem Verdienst der Ideen, und so stehe ich nicht an, das Relief näher an den Anfang als an den Schluss des oben begrenzten Zeitraums zu setzen. Wenn Sie daher auch aus andern Gründen an die Zeit des Lysimachos denken, so habe ich dagegen von archäologischer Seite durchaus keine Einwendung zu machen, freue mich vielmehr, unseren Monumentenschatz mit einem Originalwerk aus jener Zeit bereichert zu sehen.“
Ich bewies vorhin die Verwandtschaft der vier verschiedenen Völker, welche die Baustelle Trojas vor Ankunft der griechischen Kolonie bewohnt haben, durch die bei allen massenweise vorkommenden kleinen Terrakotta-Vulkane und -Karusselle und durch die Ähnlichkeit der auf denselben eingravierten religiösen Symbole. Ich beweise diese Verwandtschaft ferner und vor allen Dingen durch die plastische Darstellung der Minerva, der Schutzgöttin Iliums, mit einem Eulengesicht, denn diese Darstellung ist allen vier Völkern eigen, welche hier der griechischen Kolonie vorausgegangen sind. Sogleich unter den Trümmerschichten der letzteren, in 2 Meter Tiefe, fand ich dies Eulengesicht mit einer Art von Helm auf Terrakotta-Bechern, die auch in allen folgenden Schuttschichten, bis in 12 Meter Tiefe, vorkommen und sich bis in 9 Meter Tiefe sehr häufig finden. Diese Becher mögen auch, wie mein gelehrter Freund Emile Burnouf meint, nur als Deckel der gleichzeitig mit ihnen vorkommenden
Vasen mit zwei emporstehenden Flügeln, zwei Frauenbrüsten und einem großen Schamteil gedient haben, denn sie passen vollkommen auf dieselben. Ich fand gleichzeitig von 3 Meter Tiefe abwärts in allen Trümmerschichten bis zu 10 Meter Tiefe Vasen mit Eulengesichtern, zwei emporstehenden Flügeln (nicht Armen, wie ich früher meinte), zwei großen Frauenbrüsten und einem sehr großen Schamteil, und sogar, in 6 Meter Tiefe, eine Vase, auf welcher der Schamteil mit einem Kreuz und vier Nägeln verziert ist. Ich fand selbst in 14 Meter Tiefe den oberen Teil einer Vase und die Scherbe einer Schüssel mit Eulengesichtern geschmückt. Außerdem fanden sich von 2 Meter Tiefe abwärts in allen Schuttschichten bis zum Urboden 2½ bis 18½ Zentimeter lange und 1½ bis 12 Zentimeter breite Idole aus sehr feinem Marmor, aus Knochen, aus Glimmerschiefer, aus Schiefer oder selbst aus ganz ordinärem Kalkstein; auf sehr vielen derselben sieht man ein Eulengesicht, und auf einigen außerdem sogar Frauenhaar auf der Stirn eingraviert; auf vielen sieht man auch einen Frauengürtel eingeschnitten. Da ich auf mehreren Idolen ohne eingeschnittenen Eulenkopf diesen mit roter oder schwarzer Farbe dargestellt finde, so vermute ich, dass ein Gleiches einst mit allen Idolen der Fall war, auf welchen die Kennzeichen der Eule jetzt fehlen, und dass auf diesen die Farbe im Laufe der Jahrtausende durch die Feuchtigkeit verloren gegangen ist. Auf mehreren Idolen aus Marmor oder Knochen sind die Flügel an den Seiten angedeutet. Ich fand aber auch den versteinerten Wirbelknochen eines antediluvianischen Tiers, auf welchem die Trojaner einen großen Eulenkopf ausgeschnitten haben. Ferner fanden sich in 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 14 Meter Tiefe zwölf Idole aus Terrakotta, und sind, nur mit einer Ausnahme, auf allen Eulengesichter; die meisten haben auch zwei Frauenbrüste und auf der Rückseite angedeutetes langes Frauenhaar. Eins dieser eulenköpfigen Idole ist in Form eines Gefäßes und hat an jeder Seite einen Schlauch in Gestalt eines kleineren Gefäßes; der vordere Körper der Göttin bis zum Hals ist bedeckt mit einem langen Schild, und auf der Rückseite sieht man das Frauenhaar, auf Art der Karyatiden in der Akropolis in Athen, lang herunterhängen. Auch auf mehreren dieser Idole von Terrakotta sind Flügel angedeutet.
Diese auf Bechern, Vasen und Idolen vielfältig vorkommenden Eulengesichter mit Frauengestalt können nur eine Göttin darstellen, und diese Göttin kann nur Minerva, die Schutzgöttin Trojas, sein um so mehr als sie Homer fortwährend „θεα γλανχῶπις Ἀθήνη“ nennt; denn „γλανχῶπις“ ist von den Gelehrten aller Jahrhunderte falsch übersetzt, und bedeutet nicht „mit feurigen oder funkelnden Augen“, sondern es bedeutet „mit Eulengesicht“. Die natürliche Schlussfolgerung ist, erstens, dass es dem Homer vollkommen bekannt war, dass Minerva mit dem Eulengesicht Iliums Schutzgöttin war; zweitens, dass der Ort, in dessen Tiefen ich seit drei Jahren wühle, die Stätte sein muss „ubi Troja fuit“; und drittens, dass bei fortschreitender Zivilisation Pallas Athene ein menschliches Gesicht erhielt und aus ihrem frühem Eulenkopf ihr Lieblingsvogel, die Eule, gemacht wurde, welche als solcher dem Homer ganz unbekannt ist.
Es kommen in 4 bis 9 Meter Tiefe auch einige Vasen und Becher mit einem Menschengesicht vor, welches aber vieles von der Eule hat.
Da ich keine Spur des Eulengesichts in den Trümmerschichten der griechischen Kolonie finde, so ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass diese schon weiter in der Kultur fortgeschritten war als die Ilier, deren Stadt sie in Besitz nahm, und dass sie schon die Vorstellung der Schutzgöttin mit menschlichem Gesicht mit nach Troja brachte.
Was die mehrfach erwähnten, mit religiösen Symbolen geschmückten runden durchbohrten Stücke Terrakotta in Gestalt des Karussells oder des Vulkans betrifft, so ist es immerhin möglich, dass ihre ursprüngliche Form die des Rades gewesen ist, denn in dieser Gestalt kommen sie mehrfach auf dem Urboden, in 14 und 16 Meter Tiefe vor. In den höheren Schuttschichten ist zwar bei diesen Stücken die Form des Rades selten, aber die durch Einschnitte bewirkte Darstellung des in Bewegung befindlichen Rades kommt doch noch sehr häufig vor. Trotz allen Forschens und Grübelns ist es mir noch nicht gelungen, zur Einsicht zu kommen: zu welchem Zweck diese äußerst interessanten Gegenstände gebraucht worden sind, die, wie sich jetzt beim Ausgraben des Minervatempels herausgestellt hat, nur bei den der griechischen Kolonie vorangegangenen Völkern mit indogermanischen symbolischen Zeichen geschmückt worden sind, in der griechischen Ansiedlung aber nur noch einzeln, auch in abweichender Form und ganz ohne eingeschnittene Verzierungen vorkommen und durch die runden und viel größeren zweimal durchbohrten Stücke Terrakotta ersetzt werden, welche hin und wieder eine Art von Stempel tragen.
Durch die Güte meines geehrten Freundes, des Professors Giuseppe G. Bianconi in Bologna, erhielt ich die Zeichnungen von zehn solchen, sich im Museum von Modena befindenden, runden Stücken Terrakotta in der Form des Karussells und des Vulkans, welche in den Terramares der dortigen Gegend, in den Pfahlbauten aus der Steinzeit, gefunden wurden. Zu meinem größten Erstaunen sehe ich darunter sechs mit den nämlichen eingeschnittenen Verzierungen, die ich auf den Stücken gleicher Gestalt hier in Troja finde. Drei derselben haben im Kreise um die Zentralsonne ein dreifaches Kreuz, welches, wie ich bemüht gewesen bin in meinem sechsten Aufsatz ausführlich auseinanderzusetzen, als Bild der beiden Hölzer unserer Urväter zur Hervorbringung des heiligen Feuers, ein Symbol höchster Wichtigkeit war; das vierte stellt eine solche Feuermaschine mit fünf Enden dar, und werden die Indologen vielleicht finden, dass einer der Stäbe das „pramantha“ genannte Stück Holz darstellt, womit das Feuer durch Reibung hervorgebracht wurde und von dem die Griechen in späterer Zeit den Prometheus machten, den sie das Feuer vom Himmel stehlen ließen. Das fünfte zeigt eine etwas verschiedene Form der Feuermaschine unserer Urväter, und das sechste hat zwölf Kreise um die Zentralsonne. Wahrscheinlich sind dies die im Rigveda so oft vorkommenden zwölf Stationen der Sonne, welche personifiziert sind durch die zwölf Adityas, Söhne des Adity (des Unteilbaren oder des unendlichen Raumes), und die zwölf Zeichen des Tierkreises darstellen.
Derselbe Freund schickte mir auch die Zeichnungen von achtzehn solchen, aus den Gräbern des Kirchhofs von Villanova stammenden und im Museum des Grafen Gozzadini in Bologna befindlichen runden Stücken Terrakotta. Da der Graf in einem der Gräber ein „aes rude“ gefunden hat, so glaubt er, dass, so wie dies, so auch der Kirchhof, aus der Zeit des Königs Numa stamme und somit aus zirka 700 v. Chr. G. de Mortillet (Le Signe de la Croix, S.88–89) hingegen schreibt dem Kirchhof ein viel größeres Alter zu. Jedenfalls aber haben fünfzehn der vorliegenden achtzehn Zeichnungen, im Vergleich zu den zehn im Museum von Modena, sowie auch im Vergleich mit meinen hier in Troja gefundenen kleinen Karussells, Vulkanen und Rädern, ein modernes Aussehen, denn nicht nur die Verzierungen, sondern auch die Form der Stücke sind viel mehr gekünstelt. Nur drei der achtzehn Stücke zeigen eine Gestalt und Verzierungen, wie sie auch hier in Troja vorkommen. Alle drei haben die Form des Karussells; das eine hat sieben Sonnen im Kreis um die Zentralsonne; das zweite hat zwei Kreuze, deren eins durch vier Sterne, das andere durch vier Striche gebildet wird. Das dritte hat fünf fünffache Dreiecke und fünf Sterne im Kreise um den Mittelpunkt. Der Vergleich dieser achtzehn Stücke mit den trojanischen bringt mich zur Überzeugung, dass Graf Gozzadini recht hat, wenn er dem Kirchhof von Villanova kein höheres Alter als 700 v. Chr. zuschreibt.
Außer den mit religiösen Symbolen verzierten Stücken kommen aber auch in Troja Tausende von Terrakottas ähnlicher, aber meistens mehr gedehnter Form vor, die gar keine Verzierungen haben; in 3 Meter Tiefe kommen sie auch in Gestalt des Kegels vor. Früher fand ich in 3 Meter Tiefe solche Stücke auch aus blauem oder grünem Stein, die ich in letzter Zeit aber auch in 7 bis 10 Meter Tiefe häufig antraf. Unter den unverzierten Terrakottas dieser Art finde ich einige, aber kaum mehr als 2 Prozent, die einige Abnutzung zeigen und am Spinnrad gebraucht sein mögen. Die mit Einschnitten verzierten Stücke dagegen zeigen niemals irgendwelche Abnutzung, und die auf denselben eingravierten symbolischen Zeichen sind mit einer weißen Tonerde ausgefüllt, damit sie mehr in die Augen fallen.
Diese Aussage bedarf einer zusätzlichen Erläuterung: Die Notizen Hr. Burnouf Zeichnungen, die Dr. Schliemann für dieses Buch geliefert hat, beschreiben häufig die verzierten Karusselle als abgegriffen und abgenutzt, speziell an der unteren Seite und durch eine drehende Bewegung. Dies unterstützt die These, dass es sich dabei um Spindeln zum Spinnen handelt. (Anm. der englischen Ausgabe)
Diese weiße Tonerde hätte beim Gebrauch der Stücke am Spinnrad oder als Münze sogleich verloren gehen müssen. Als Amulette können die Stücke ihrer Größe und Schwere wegen nicht getragen worden sein. Ich muss daher glauben, dass sie als Opfergaben angewandt oder als Idole der Sonne angebetet wurden, deren Bild man im Mittelpunkt sieht. Wie es leider bei der Größe meiner Ausgrabungen, bei der Eile, mit welcher dieselben betrieben wurden, und bei der Härte des Schutts nicht anders möglich war, kam bei weitem der größere Teil der von mir in den Tiefen Iliums gefundenen Terrakotta-Gefäße in mehr oder weniger zerbrochenem Zustand heraus. Ich habe aber alles, was nur irgend repariert werden konnte, mittels Schellack und Gips wiederhergestellt, und tritt letzterer in den Photographien hervor. Überall wo von einem Teil etwas abgebrochen war und fehlte, habe ich denselben nach dem Modell anderer heil herausgekommener Gefäße derselben Art restauriert; wo mir aber ein solches Modell entbrach, oder wo ich die geringste Ungewissheit hatte, da habe ich die Restauration ganz unterlassen.
Die Stadt Ilium, auf deren Baustelle ich seit mehr als drei Jahren gegraben habe, gab sich für die Nachfolgerin von Troja aus, und da im ganzen Altertum der Glaube an die Identität seiner Baustelle mit jener der alten Stadt des Priamos fest begründet war und niemand daran gezweifelt hat, so ist es gewiss, dass die gesamte Tradition diese Identität bestätigte. Endlich erhob sich dagegen Strabo, der jedoch, wie er selbst sagt, die Ebene von Troja niemals besucht hatte und sich auf die von Eigennutz eingegebenen Berichte des Demetrius von Skepsis verließ. Nach Strabo (ΧΙII, 1, S. 122, Tauchn. Ausg.) behauptete dieser Demetrius, seine Geburtsstadt, Skepsis, sei die Residenz des Aeneas gewesen, und beneidete Ilium um die Ehre, die Hauptstadt des trojanischen Reichs geworden zu sein. Deshalb sprach er die Ansicht aus: in Ilium und Umgegend sei für die großen Taten der Ilias nicht Raum genug, und das ganze Terrain, welches die Stadt vom Meer trennte, sei angeschwemmtes Land und habe sich erst nach dem trojanischen Kriege gebildet. Als einen anderen Beweis, dass die Stelle der beiden Städte nicht dieselbe sein könnte, führt er an: Achilles und Hektor seien dreimal um Troja gelaufen, während man um Ilium nicht herumlaufen könnte „διά τήν δυνεχῆ ῥάχην“, wegen des fortlaufenden Bergrückens. Aus allen diesen Gründen müsse man das alte Troja an die Stelle von Ἰλιέων χώμη, 30 Stadien von Ilium und 42 Stadien von der Küste, verlegen, obwohl er allerdings zugestehen muss, dass sich nicht die geringste Spur davon erhalten habe (Strabo, ΧΙII, 1, S. 99).
Strabo würde gewiss bei dem ihn kennzeichnenden richtigen Urteil alle diese irrtümlichen Behauptungen des Demetrius von Skepsis verworfen haben, wenn er selbst die Ebene von Troja besucht hätte, da sie sich leicht widerlegen lassen.
Ich bemerke zunächst, dass man um die Baustelle von Troja sehr bequem herumlaufen kann, ferner, dass die Entfernung von Ilium, in gerader Linie bis zur Küste, 6 Kilometer, dagegen in gerader nordwestlicher Linie bis zum Vorgebirge von Sigeum (oder Sigeion) 7 Kilometer beträgt, welches die Tradition noch zu Strabos Zeit als die Stelle des griechischen Lagers bezeichnete. Strabo sagt nämlich (XIII, 1, S. 103): „Nahe Rhoeteum sieht man die zerstörte Stadt Sigeum, den Hafen der Achäer, das achäische Lager und den Sumpf oder See, Stomalimne genannt, und die Mündung des Skamanders.“
Auf der Baustelle von „Ἰλιέων χώμη“ habe ich im November 1871 Ausgrabungen gemacht, deren Resultat die Theorie des Demetrius von Skepsis vollkommen umwirft, denn überall fand ich den Urboden in weniger als ½ Meter Tiefe, und die auf einer Seite der Baustelle weit fortlaufende Anhöhe, welche die Trümmer einer großen Stadtmauer zu bergen scheint, enthält nur rein
Das vorliegende Werk ist eine Art von Tagebuch meiner Ausgrabungen in Troja, denn alle Aufsätze, woraus es besteht, sind, wie die Lebhaftigkeit der Schilderungen es beweist, an Ort und Stelle, beim Fortschreiten der Arbeiten, von mir niedergeschrieben.
Wenn meine Aufsätze hin und wieder Widersprüche enthalten, so hoffe ich, dass man mir diese zugute halten wird, wenn man berücksichtigt, dass ich hier eine neue Welt für die Archäologie aufgedeckt, dass man bis jetzt noch nie oder nur höchst wenige solcher Sachen gefunden, wie ich sie zu Tausenden ans Licht gebracht, dass mir daher alles fremd und rätselhaft erschien, und ich somit oft Vermutungen wagte, die ich bei reiflicher Überlegung wieder umwerfen musste, bis ich endlich zur gründlichen Einsicht gelangte und auf viele tatsächliche Beweise gegründete Schlüsse ziehen konnte.
Eine meiner größten Schwierigkeiten ist es aber gewesen, die enorme Schuttaufhäufung in Troja mit der Chronologie in Einverständnis zu bringen, und ist mir dies trotz langem Forschen und Grübeln nur teilweise gelungen. Nach Herodot (VII, 43): „kam Xerxes bei seinem Zug durch Troas vor seinem Einfall in Griechenland (also im Jahre 480 v. Chr.) am Skamander an und stieg zu Priams Pergamos hinauf, weil er das Verlangen hatte, diese Burg zu sehen; und nachdem er sie gesehen und sich nach ihren Schicksalen erkundigt hatte, opferte er der ilischen Minerva 1000 Rinder, und die Magier brachten den Manen der Helden Trankopfer dar".
Aus dieser Stelle geht stillschweigend hervor, dass damals eine griechische Kolonie schon seit langer Zeit die Stadt innehatte, und nach dem Zeugnis Strabos (XIII, I, 42) erbaute dieselbe Ilium unter der Herrschaft der Lydier. Da nun der Anfang der lydischen Herrschaft auf 797 v. Chr. festgestellt wird und die Ilier bei der Ankunft des Xerxes, im Jahr 480 v. Chr., dort längst vollkommen eingerichtet gewesen zu sein scheinen, so darf man wohl annehmen, dass ihre Niederlassung in Troja ungefähr 700 Jahre v. Chr. erfolgt ist. Die Hausmauern hellenischer Architektur, von großen Steinen ohne Zement, sowie die Überbleibsel des griechischen Hausgeräts, reichen aber in den Ausgrabungen auf der platten Fläche des Berges nie tiefer als 2 Meter.
Da ich in Ilium keine späteren Inschriften als vom 2. Jahrhundert n. Chr. und keine Medaillen später als Constans II. und Konstantin II., von diesen beiden Kaisern aber sowie von Konstantin I., dem Gossen, sehr viele finde, so ist bestimmt anzunehmen, dass schon vor der Zeit des letzteren, der bekanntlich anfänglich dort Konstantinopel zu bauen beabsichtigte, die Stadt in Verfall kam, jedoch ungefähr bis zum Ende der Regierung Constans’ II., sage bis 361 n. Chr., ein bewohnter Ort blieb. Aber die Schuttaufhäufung in dieser langen Periode von 1061 Jahren beträgt nur 2 Meter, während man unterhalb derselben noch 12 Meter oder 40 Fuß, und auf vielen Stellen gar 14 Meter oder 46½, Fuß tief zu graben hat, ehe man den Urboden erreicht, der aus einem Muschelkalkfelsen besteht. Diese gewaltige, 40 bis 46½ Fuß dicke Schuttdecke, welche von den vier verschiedenen Völkern herrührt, die, das eine nach dem anderen, den Berg vor Ankunft der griechischen Kolonie, also vor 700 v. Chr., bewohnt haben, ist ein unermesslich reiches Füllhorn der merkwürdigsten, bisher nie gesehenen Terrakottas und anderer Gegenstände, die nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit den Erzeugnissen hellenischer Kunst haben. Die Frage drängt sich nun auf: ob nicht diese enorme Trümmermasse vielleicht von einem anderen Ort hierher gebracht worden ist, um den Berg zu erhöhen? Eine solche Hypothese ist, wie sich jeder Besucher meiner Exkavationen auf den ersten Blick überzeugen kann, ganz unmöglich, weil man in allen Schuttschichten, vom Felsen in 14 und 16 Meter (46 bis 53½ Fuß) Tiefe ab bis zu 4 Meter unter der Oberfläche fortwährend Reste gemauerter Wände sieht, die auf starken Fundamenten ruhen und von wirklichen Häusern herrühren, und außerdem, weil alle die zahlreichen großen Wein-, Wasser- und Leichenurnen, denen man begegnet, aufrecht stehen. Die Frage ist dann: aber wie viele Jahrhunderte sind erforderlich gewesen, um von den Trümmern der vorgriechischen Haushaltungen eine Schuttdecke von 40 bis 46½ Fuß Dicke zu bilden, wenn zur Formierung der obersten, der griechischen Schuttdecke, von 2 Meter oder 6½ Fuß Dicke, 1061 Jahre erforderlich waren? Ich habe in meinen dreijährigen Ausgrabungen in den Tiefen Trojas täglich und stündlich Gelegenheit gehabt, mich zu überzeugen, dass wir uns, nach dem Maßstab unserer eigenen oder der altgriechischen Lebensweise, von dem Leben und Treiben der vier Völker, welche das eine nach dem anderen vor der Zeit der griechischen Ansiedlung diesen Berg bewohnt haben, gar keinen Begriff machen können; es muss heillos bei ihnen zugegangen sein, denn sonst könnte man nicht in beständiger unregelmäßiger Reihenfolge auf den verschütteten Resten des einen Hauses die Wände eines anderen finden; und eben weil wir uns keinen Begriff davon machen können, wie diese Nationen gewirtschaftet und welche Kalamitäten sie zu ertragen gehabt haben, können wir unmöglich nach der Dicke ihrer Trümmer die Dauer ihrer Existenz auch nur annähernd berechnen. Höchst merkwürdig, aber durch die fortwährenden Kalamitäten, welche diese Stadt befallen haben, vollkommen erklärlich ist es, dass bei allen vier Völkern die Zivilisation stets abgenommen hat; die Terrakotten, welche fortwährende décadence zeigen, lassen keinen Zweifel darüber.
Die erste Ansiedlung dieses Berges scheint jedenfalls von längster Dauer gewesen zu sein, denn ihre Trümmer bedecken den Felsen bis zu einer Höhe von 4 und 6 Meter. Ihre Häuser und Festungsmauern waren von großen und kleinen, mit Erde verbundenen Steinen gebaut, und sieht man mehrfach Reste davon in meinen Ausgrabungen. Ich glaubte im vorigen Jahr, diese Ansiedler seien identisch mit den von Homer besungenen Trojanern, weil ich bei ihnen Bruchstücke des Doppelbechers, des homerischen δέπας ἀμφιχύπελλον gefunden zu haben vermeinte. Bei genauer Prüfung hat es sich aber herausgestellt, dass diese Bruchstücke von einfachen Bechern mit hohlem Fuß herrühren, der nie als zweiter Becher gebraucht sein kann. Überdies glaube ich in meinen diesjährigen Aufsätzen hinreichend bewiesen zu haben, dass Aristoteles (Hist. anim., IX, 40) irrtümlich dem homerischen δέπας ἀμφιχύπελλον die Gestalt einer Bienenzelle gibt, dass man von jeher diesen Becher fälschlich als Doppelbecher aufgefasst hat, und dass er nichts anderes bedeuten kann als: Becher mit einem Henkel an jeder Seite, wie solche in den Trümmerschichten der ersten Ansiedlung dieses Berges niemals, dagegen in jenen des folgenden Volkes in großen Massen, auch bei den beiden späteren Nationen, die hier der griechischen Kolonie vorausgegangen sind, vielfach vorkommen. Der große, 600 Gramm wiegende goldene Becher mit zwei Henkeln, den ich im königlichen Schatz, in 8½ Meter Tiefe, in den Trümmerschichten des zweiten Volkes fand, lässt in dieser Hinsicht keinen Zweifel übrig.
Die Terrakotten, welche ich in 14 Meter Tiefe auf dem Urboden fand, sind alle so ausgezeichneter Qualität, wie sie in keiner der höheren Schichten vorkommen; sie sind glänzend schwarz, rot oder braun, und haben eingeschnittene, mit einer weißen Masse gefüllte Verzierungen; die Schalen haben an zwei Seiten horizontale Röhren, die Vasen haben meistenteils an jeder Seite zwei senkrechte Röhren zum Aufhängen mit Schnüren; von bemaltem Terrakotta fand ich nur ein Bruchstück.
Alles was sich über die ersten Ansiedler sagen lässt, ist, dass sie arischen Stammes waren; dies beweisen zur Genüge die in ihren Trümmerschichten, sowohl auf den Topfscherben als auf den kleinen merkwürdigen durchbohrten Terrakottas in Gestalt des Vulkans und des Karussells vorkommenden indogermanischen religiösen Symbole, unter welchen man auch die Swastika sieht.
Dr. Schliemann verwendet für die verschiedenen bemerkenswerten Objekte das Wort Karussell, als Übersetzung aus dem italienischen fusaioli, Spinnwirtel oder Spindel. Diese Wort wurde auch für die Altertümer verwendet, die in den Sümpfen von Modena gefunden wurden. (Anm. der englischen Ausgabe)
Meine diesjährigen Ausgrabungen haben zur Genüge bewiesen, dass die zweite Nation, die auf diesem Berg, auf den 4 bis 6 Meter oder 13 bis 20 Fuß hohen Trümmern der ersten Ansiedler, eine Stadt erbaute, die von Homer besungenen Trojaner waren, deren Schuttschichten in 7 bis 10 Meter oder 231⁄3 bis 331⁄3 Fuß unter der Oberfläche sind. Diese trojanischen Trümmerschichten, welche ohne Ausnahme das Gepräge großer Glut tragen, bestehen hauptsächlich aus roter Holzasche und bedecken 1½ bis 3 Meter hoch Iliums großen Turm, das doppelte Skaeische Tor und die große Ringmauer, deren Bau Homer dem Neptun und dem Apollo zuschreibt, und beweisen, dass die Stadt durch eine furchtbare Feuersbrunst zu Grunde ging. Wie groß die Glut gewesen ist, zeigen auch die großen Steinplatten des vom doppelten Skaeischen Tor zur Ebene hinunterführenden Weges; denn als ich diesen Weg vor einigen Monaten bloßlegte, sahen alle Steinplatten so unversehrt aus, als wenn sie erst kürzlich gelegt worden wären; nachdem sie aber einige Tage der Luft ausgesetzt gewesen waren, fingen, auf einer Strecke von 3 Meter, die Platten des oberen Teils des Wegs, welcher der Glut ausgesetzt gewesen war, an wegzubröckeln und sind jetzt beinahe schon verschwunden, während diejenigen des unteren Teils des Wegs, welcher vom Feuer unberührt geblieben war, durchaus unversehrt geblieben sind und unverwüstlich zu sein scheinen. Ein weiteres Zeugnis von der furchtbaren Katastrophe gibt eine ½ bis 3 Zentimeter dicke Schlackenschicht aus geschmolzenem Blei-und Kupfererz, die sich in 8½ bis 9 Meter Tiefe fast durch den ganzen Berg ausdehnt. Dass Troja nach blutigem Kampf vom Feind zerstört wurde, dafür zeugen die vielen Menschenknochen, die ich in diesen Schuttschichten fand, und vor allen Dingen die in den Tiefen des Minervatempels gefundenen Gerippe mit Helmen; denn, wie wir aus Homer wissen, wurden alle Leichname verbrannt und die Asche in Urnen beigesetzt, deren ich eine gewaltige Menge in allen vorgriechischen Schuttschichten dieses Berges fand. Ferner lässt keinen Zweifel über die Zerstörung der Stadt durch Feindes Hand der von mir auf der großen Ringmauer neben dem königlichen Palast, in 8½ Meter Tiefe und mit 1½ bis 2 Meter rotem trojanischen Schutt und einer posttrojanischen, 6 Meter hohen Festungsmauer bedeckt gefundene Schatz, den wahrscheinlich jemand von der königlichen Familie während der Zerstörung versucht hat zu retten, aber gezwungen worden ist, auf der Ringmauer zurückzulassen.
Auf die Angaben der Ilias vertrauend, an deren Genauigkeit ich wie ans Evangelium glaubte, meinte ich Hissarlik, der Berg den ich seit drei Jahren durchwühlt habe, sei die Pergamos der Stadt, Troja müsse wenigstens 50.000 Einwohner gehabt und seine Baustelle müsse sich bis über die ganze Baustelle des llium der griechischen Kolonie hinaus ausgedehnt haben, dessen Plan im Maßstab von 2787⁄10000 Millimeter pro Meter ich auf Tafel 213 gebe. Dessen ungeachtet wollte ich die Sache genau untersuchen und glaubte dies nicht besser tun zu können, als durch Anlegung von Brunnen. Behutsam fing ich daher an, an den äußersten Enden des griechischen Ilium Brunnen zu graben, die aber bis zum Urboden nur Hauswände oder Mauern, sowie Bruchstücke von Töpferware aus griechischer Zeit, und keine Spur von den Trümmern der vorhergehenden Völker zum Vorschein brachten. Ich rückte daher dieser vermeintlichen Pergamos mit dem Graben von Brunnen allmählich näher, ohne besseren Erfolg, und da nun endlich gar sieben Brunnen, die ich unmittelbar am Fuß dieses Berges bis zum Felsen grub, nur griechisches Mauerwerk und nur griechische Topfscherben zum Vorschein brachten, so trete ich jetzt aufs entschiedenste mit der Behauptung hervor: dass sich Troja auf die kleine Fläche dieses Berges beschränkt hat, dass seine Baustelle genau angegeben ist durch seine von mir auf vielen Stellen bloßgelegte große Ringmauer; dass die Stadt keine Akropolis hatte und die Pergamos eine reine Erfindung Homers ist; ferner dass Trojas Baustelle in posttrojanischer Zeit bis zur griechischen Ansiedlung nur um so viel zugenommen hat, wie der Berg durch den hinunter geworfenen Schutt gewachsen ist, dass aber dem Ilium der griechischen Kolonie sogleich bei dessen Gründung eine große Ausdehnung gegeben wurde.
Wenn man sich aber einerseits hinsichtlich der Größe Trojas getäuscht sieht, so muss man doch andererseits eine große Genugtuung in der nunmehr erlangten Gewissheit empfinden, dass es wirklich ein Troja gab, dass dies Troja dem größten Teil nach von mir ans Licht gebracht ist, und dass die Ilias – wenn auch in übertriebenem Maßstab – diese Stadt und die Tatsache ihres tragischen Endes besingt. Homer ist aber nun einmal kein Historiker, sondern ein epischer Dichter, und muss man ihm die Übertreibungen zugute halten.
Da Homer die Topographie und die Witterungsverhältnisse der Troade so genau kennt, so leidet es wohl keinen Zweifel, dass er selbst Troja besucht hat; da er aber lange nach dessen Untergang kam und die Baustelle Trojas sogleich bei der Katastrophe durch die Trümmer der zerstörten Stadt tief im Schutt begraben und seit Jahrhunderten durch eine neue Stadt überbaut worden war, so konnte er weder Iliums großen Turm, noch das Skaeische Thor, noch die große Ringmauer, noch den Palast des Priamos sehen, denn, wie jeder Besucher der Troade sich in meinen Ausgrabungen überzeugen kann, lastete auf allen diesen Denkmälern unsterblichen Ruhms, schon allein von Trojas Trümmern und roter Asche, eine Decke von 1½ bis 3 Meter oder 5 bis 10 Fuß Dicke, und diese Schuttaufhäufung muss bis Homers Besuch noch sehr bedeutend zugenommen haben. Homer stellte keine Ausgrabungen an, um jene Denkmäler ans Licht zu bringen; er kannte sie aber aus der Überlieferung, denn seit Jahrhunderten war Trojas tragisches Ende im Munde aller Sänger, und das Interesse, was sich daran knüpfte, war so groß, dass, wie meine Ausgrabungen erwiesen haben, die Tradition selbst in vielen Einzelheiten genau die Wahrheit berichtete; so z. B. das Vorhandensein des Skaeischen Tors in Iliums großem Turm; der stete Gebrauch des Skaeischen Tors im Plural, weil dasselbe als doppelt geschildert worden sein muss, und in der Tat hat es sich als doppelt herausgestellt. Nach den Versen der Ilias, XX, 307—308 scheint es mir jetzt höchst wahrscheinlich, dass der König von Troja zur Zeit von Homers Besuch sein Geschlecht in gerader Linie von Aeneas abzustammen vorgab.
Weil nun Homer Iliums großen Turm und das Skaeische Tor nicht sah, sich nicht denken konnte, dass diese Bauten tief unter seinen Füssen begraben ruhten, sich auch wohl – nach den damals bestehenden Gesängen – Troja als sehr groß vorstellen mochte und es vielleicht noch größer zu schildern wünschte, so ist es nicht zu verwundern, wenn er Hektor vom Palast in der Pergamos heruntersteigen und die Stadt durcheilen lässt, um ans Skaeische Tor zu gelangen, während dieses in der Wirklichkeit, ebenso wie Iliums großer Turm, in welchem es sich befindet, unmittelbar vor dem königlichen Haus ist. Dass dies Haus wirklich des Königs Haus ist, das scheint durch seine Grösse, durch die Dicke seiner steinernen Mauern, im Gegensatz zu den übrigen fast ausschliesslich von ungebrannten Ziegeln erbauten Häusern der Stadt, durch seine imposante Lage auf einem künstlichen Hügel unmittelbar vor oder neben dem Skaeischen Tor, dem großen Turm und der großen Ringmauer, ferner durch die darin gefundenen vielen herrlichen Sachen, namentlich durch die ungeheure, königlich geschmückte Vase mit dem Bild der eulenköpfigen ilischen Schutzgöttin Minerva, weiter, und vor allen Dingen, durch den unmittelbar neben demselben gefundenen reichen Schatz hervorzugehen. Ich kann natürlich nicht beweisen, dass der Name des Königs, des Besitzers des Schatzes, wirklich Priamus war, ich nenne ihn aber so, weil er mit diesem Namen von Homer und von der ganzen Tradition genannt wurde. Alles was ich beweisen kann, ist, dass der Palast dieses Besitzers des Schatzes, dieses letzten trojanischen Königs, gleichzeitig mit dem Skaeischen Tor, der großen Ringmauer und dem großen Turm in der großen Katastrophe untergegangen ist, welche die ganze Stadt verheerte. Ich beweise durch jene 1½ und 3 Meter hohen roten und gelben kalzinierten trojanischen Trümmermassen, womit alle diese Bauten bedeckt wurden und eingehüllt blieben, und durch die vielen posttrojanischen Bauten, die wiederum auf diesen kalzinierten Trümmermassen errichtet wurden, dass weder der Palast des Schatzinhabers noch das Skaeische Tor, noch die große Ringmauer, noch Iliums großer Turm jemals wieder ans Tageslicht gekommen sind. Eine Stadt, deren König einen solchen Schatz besaß, war für damalige Verhältnisse unermesslich reich, und weil Troja reich war, so war es mächtig, hatte viele Untertanen und erhielt Hilfstruppen von allen Seiten.
Ich schrieb im vorigen Jahr den Bau von Iliums großem Turm den ersten Ansiedlern dieses Berges zu, bin jedoch längst zur festen Überzeugung gekommen, dass er vom zweiten Volk, den Trojanern, herrührt, da er auf der Nordseite nur innerhalb der trojanischen Trümmerschichten und 5 bis 6 Meter oberhalb des Urbodens wirkliches Mauerwerk hat. Ich habe in meinen Briefen wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass die von mir auf dem Turm gefundenen Terrakotten nur jenen aus 11 bis 14 Meter Tiefe zur Seite gestellt werden können. Dies gilt aber nur für die Schönheit des Tons und die Eleganz der Gefäße, keineswegs aber für die Typen derselben, die – wie man sich im Atlas dieses Werks überzeugen kann – durchaus verschieden sind von denen der Tongefäße der ersten Ansiedler.
Man glaubte bisher, das Vorfinden von steinernen Werkzeugen bezeichne die Steinperiode; meine Ausgrabungen hier in Troja stellen jedoch diese Meinung als durchaus irrig heraus; denn sehr häufig finde ich schon gleich unterhalb der Trümmerschichten der griechischen Kolonie, d. h. schon in 2 Meter Tiefe, steinerne Werkzeuge, die von 4 Meter Tiefe abwärts in sehr großen Massen vorkommen, jedoch in den trojanischen Trümmerschichten, in 7 bis 10 Meter unterhalb der Oberfläche, im allgemeinen viel besser gearbeitet sind. Ich mache ganz besonders darauf aufmerksam, dass ich leider bei Anfertigung des vorstehenden Werks in den mir jetzt unbegreiflichen Irrtum verfallen bin, jene herrlich geschliffenen Waffen und Werkzeuge, die meistenteils aus Diorit, aber oft auch aus sehr hartem durchsichtigen grünen Stein sind, die in dieser und anderen Abbildungen dargestellt sind, Keile zu nennen. Wie sich jeder überzeugen kann, sind es aber keine Keile, sondern Beile oder Äxte, und die meisten derselben werden als Streitäxte gebraucht worden sein; ja viele scheinen, nach ihrer Form zu urteilen, sich ausgezeichnet als Lanzen zu eignen und mögen als solche benutzt worden sein. Ich habe viele Hunderte davon gesammelt. Gleichzeitig aber mit den Tausenden von steinernen Werkzeugen finde ich auch viele kupferne, und beweisen die viel vorkommenden Formsteine aus Glimmerschiefer zum Gießen von kupfernen Waffen und Werkzeugen, sowie die vielen kleinen Schmelztiegel und roh gemachten kleinen Näpfe, Löffel und Trichter zum Füllen der Formen, dass dies Metall viel gebraucht wurde, worüber außerdem die erwähnte Schicht von Kupfer- und Bleischlacken in 8½ bis 9 Meter Tiefe keinen Zweifel lässt. Zu bemerken ist, dass alle vorkommenden kupfernen Gegenstände aus reinem Kupfer sind, ohne jegliche Beimischung eines anderen Metalls. Ja, der Schatz des Königs enthielt davon einen Schild mit großem Nabel, eine große Kasserolle, einen Kessel oder Vase, eine lange Platte mit in der Feuersbrunst darauf geschmolzener silberner Vase, viele Bruchstücke anderer Vasen, wovon eine mit zwei Röhren an jeder Seite zum Aufhängen mit Schnüren; eine andere mit krummen, sehr künstlichen Griffen an den Seiten und einer wahrscheinlich am oberen Teil befestigt gewesenen krummen Röhre sehr niedlicher Form, dreizehn Lanzen, vierzehn jener hier häufig vorkommenden, anderswo aber noch niemals gefundenen Waffen, die nach einem Ende spitz aber stumpf, nach dem andern in eine breite Schneide auslaufen; ich hielt sie früher für Lanzen, bin aber jetzt zur Überzeugung gekommen, dass sie nur als Streitäxte gebraucht sein können, obwohl sie kein Loch in der Mitte haben. Ich fand dort weiter sieben große zweischneidige Dolchmesser, ein gewöhnliches Messer sowie einen großen Schlüssel, der wahrscheinlich zu der hölzernen Kiste gehört hat, in welcher man versucht hat, den Schatz zu retten. Da alle Gegenstände des Schatzes dicht zusammengepackt waren und einen viereckigen Raum einnahmen, so kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass sie in einer hölzernen Kiste enthalten waren.
Außer dem bereits vorhin erwähnten großen goldenen Becher, welcher gegossen ist und dessen beide gewaltigen, hohlen Griffe darangeschmiedet sind, fand ich im Schatz eine 403 Gramm wiegende kugelrunde goldene Flasche, einen 226 Gramm wiegenden einfachen goldenen Becher; einen kleinen Becher von 70 Gramm, der nicht aus reinem Golde ist, und sind die drei letzteren Gegenstände mit dem Hammer getrieben (δφυρήλατα); ferner 60 herrliche goldene Ohrringe, worunter vier beinahe in Korbform, mit prachtvollen, von fünf oder sechs Kettchen mit Idolen der eulenköpfigen Schutzgöttin gebildeten Gehängen, und sechs goldene Armbänder, wovon drei geschlossen sind und zu beweisen scheinen, dass die Hände der Trojanerinnen viel kleiner gewesen sein müssen als die jetzigen Frauenhände, denn ein jetziges Mädchen von 10 Jahren würde Mühe haben, ihre Hand durchzustecken; auch die Öffnung der drei nicht geschlossenen Armbänder, welche doppelt sind, beweist, dass sie von Frauen mit ungemein kleinen Händen getragen sind. Weiter fand ich im Schatz ein goldenes Stirnband (ἄμπυξ) und zwei wundervolle goldene Diademe (χρήδεμνα), wovon das eine sechzehn herunterhängende Kettchen mit Idolen der ilischen Schutzgöttin und 74 andere mit Baumblättern verzierte Kettchen hat; das zweite Diadem hat 61 herunterhängende Kettchen mit Idolen derselben Göttin. Ich fand weiter im Schatz nicht weniger als 8750 kleine, kunstvoll gearbeitete durchbohrte Gegenstände aus Gold, wie Zylinder, ausgezackte Scheibchen, Kugeln, Prismen, Würfel, mit einer Röhre zum Aufziehen versehene Baumblätter, einfache, doppelte oder dreifache Ringe mit durchgehendem Loch an zwei Seiten, Stücke ganz in Form kleiner Glockenzungen, Knöpfe mit einer Öse, sowie Doppelknöpfe, die aber nicht wie unsere Hemdknöpfe, zusammengeschmiedet, sondern einfach zusammengesteckt sind, denn aus der Höhlung des einen kleinen Knopfes steht eine kleine Röhre (αύλίδχος), aus der des andern eine Stange (ἔμβολον) hervor, und steckt man letztere in die erstere, um den Doppelknopf herzustellen. Auf mehr als einem Drittel dieser kleinen Gegenstände sieht man eingeschnittene Verzierungen von acht oder sechzehn Rillen, die oft so fein gemacht sind, dass man nur mittels einer Lupe im Stande ist, sie zu unterscheiden und ihre große Symmetrie zu bewundern. Diese 8750 kleinen goldenen Gegenstände dienten wahrscheinlich teils an Halsschnüren, teils an Schmucksachen auf Leder. Der Schatz enthielt ferner sechs an einem Ende abgerundete an dem anderen in Form des Halbmondes ausgeschnittene Klingen aus allerreinstem Silber, deren Gewicht leider neben den Abbildungen Tafel 200 nicht genau angegeben ist; sie wiegen 171, 173, 174, 183 und 190 Gramm; nur zwei der Stücke haben genau dasselbe Gewicht von 174 Gramm; ferner einen silbernen Becher und drei große silberne Vasen; auf einer derselben ist viel Kupfer, auf einer andern das Bruchstück einer kleineren silbernen Vase in der Feuersbrunst festgeschmolzen. Der Schatz enthielt ferner zwei kleinere äusserst kunstvoll gearbeitete silberne Vasen mit Deckeln, in Form von langen phrygischen Hüten, und hat die eine an jeder Seite ein, die andere an jeder Seite zwei Röhrchen für die Schnüre zum Aufhängen. Es gehört höchst wahrscheinlich auch noch zum Schatz eine acht Tage vor dessen Entdeckung daneben gefundene große silberne Vase, in welcher ich einen großen herrlichen Becher fand, der, wie sich jetzt herausgestellt hat, aus Elektron ist und nicht aus Silber, wie ich irrtümlich im vorletzten Aufsatz dieses Buchs berichtet habe. Auch vier silberne Schalen (φιάλαι) enthielt der Schatz, denn die eine derselben fand ich mit den anderen Gegenständen zusammen, die drei übrigen einige Tage später am Abhang der großen Ringmauer, etwa 1 Meter unterhalb des Schatzes. Der durch seine vielen wichtigen Entdeckungen und Schriften berühmte Professor der Chemie Landerer in Athen, welcher auch alle silbernen Sachen des Schatzes genau untersucht hat, findet die beiden kleinen Vasen aus ganz reinem Silber, während die vier großen Vasen, der kleine Becher und die vier Schalen 95 Prozent Silber und 5 Prozent Kupfer enthalten, welches, wie er sagt, beigemischt ist, um dem Silber größere Härte zu geben und es mit dem Hammer treiben zu können.
Dieser in großer Tiefe, in den Ruinen der für mythisch angesehenen Stadt Troja von mir entdeckte große Schatz des für mythisch gehaltenen Königs Priamos aus dem mythischen heroischen Zeitalter, ist jedenfalls eine in der Archäologie einzig dastehende Entdeckung großen Reichtums, großer Zivilisation und großen Kunstsinns in einer der Erfindung der Bronze vorhergehenden Zeit, in einer Zeit, wo man Waffen und Werkzeuge aus reinem Kupfer gleichzeitig mit gewaltigen Massen steinerner Waffen und Werkzeuge anwandte. Dieser Schatz lässt auch keinen Zweifel, dass Homer wirklich dergleichen goldene und silberne Sachen gesehen haben muss, wie er fortwährend beschreibt; in jeder Beziehung ist er von unermesslicherem Wert für die Wissenschaft und wird jahrhundertelang der Gegenstand eingehender Forschungen bleiben.
Leider finde ich auf keinem der Gegenstände des Schatzes eine Inschrift, auch kein anderes religiöses Symbol als die an den beiden Diademen (χρήδεμνα) und an den vier Ohrgehängen prangenden 100 Idole der homerischen „θεὰ γλανχῶπις Άδήνη“, welche uns aber den unumstößlichen Beweis geben: dass der Schatz der Stadt und dem Zeitalter angehören, welche Homer besingt.
Indessen fehlte die Schriftsprache zu jener Zeit nicht, und fand ich z. B. in 8 Meter Tiefe, im königlichen Palast, die oben abgebildete Vase mit einer Inschrift, und mache ich ganz besonders darauf aufmerksam, dass von den in derselben vorkommenden Schriftzügen der dem griechischen Ρ ähnliche Buchstabe auch schon in der Inschrift auf dem aus 7 Meter Tiefe stammenden Petschaft, Bild unten, der zweite und dritte Buchstabe, links von diesem, auf dem ebenfalls aus 7 Meter Tiefe stammenden, kleinen Vulkan aus Terrakotta (siehe Kapitel 11, Bild No. 145 und 146), auch der dritte Buchstabe auf den aus 3 Meter Tiefe stammenden beiden kleinen Trichtern aus Terrakotta, vorkommt.
Ich fand ferner im königlichen Palast die auf Tafel 190, No. 3474 abgebildete ausgezeichnet eingravierte Inschrift, finde hier aber nur ein Schriftzeichen, welches einem Buchstaben der Inschrift des erwähnten Petschafts ähnlich ist. Mein geehrter Freund, der große Indiologe Herr Emile Burnouf, vermutet, dass alle diese Schriftzeichen einem sehr alten gräco-asiatischen Lokalalphabet angehören. Professor H. Brunn in München schreibt mir, dass er diese Inschriften dem Professor Haug gezeigt und dieser auf Verwandtschaft und Zusammenhang mit dem Phönizischen hingewiesen habe (von dem allerdings das griechische Alphabet abhängig ist), und ferner auf gewisse Analogien mit der Inschrift der Erztafel, die zu Idalion auf Zypern gefunden und jetzt im Kabinet des médailles zu Paris ist.
Professor Brunn fügt hinzu, dass Beziehungen der trojanischen Funde zu Zypern in keiner Weise auffallen, sondern sich vielmehr sehr wohl mit Homer vertragen würden; dass jedenfalls auf diese Beziehungen ein Hauptaugenmerk zu richten ist, da nach seiner Meinung Zypern die Wiege der griechischen Kunst, oder sozusagen der Kessel ist, in dem asiatische, ägyptische, griechische Ingredienzen zusammengebraut wurden, aus denen sich später die griechische Kunst abklärte.
Herrliche Töpferware, und besonders große und kleine Becher mit zwei Henkeln oder mit einem Griff von unten in Form einer Krone, Vasen mit Röhren an den Seiten und in gleicher Richtung mit Löchern im Mund zum Aufhängen mit Schnüren, ferner alle anderen Arten von Hausgerät finde ich in diesen trojanischen Trümmerschichten in großer Häufigkeit, auch eine schön verzierte knöcherne Flöte, mehrere Teile von anderen Flöten und das herrlich verzierte elfenbeinerne Stück einer Leier mit nur vier Saiten.
Ebenso wie die ersten Siedler dieser heiligen Stätte waren auch die Trojaner Indogermanen, denn ich finde bei ihnen in gewaltigen Massen die mit eingeschnittenen religiösen Symbolen bedeckten kleinen Stücke Terrakotta in Gestalt des Vulkans und des Karussells.
Das Baumaterial der Trojaner ist verschiedener Art; mit seltener Ausnahme bestehen alle von mir ans Licht gebrachten Hauswände nur aus ungebrannten, an der Sonne getrockneten Ziegeln, von denen durch die Glut der Feuersbrunst eine Art von wirklich gebrannten Ziegeln geworden ist; der königliche Palast aber, sowie zwei kleine Bauten in den Tiefen des Minervatempels, Iliums großer Turm, das Skaeische Tor und die große Ringmauer bestehen dagegen aus mit Erde vereinigten, meistens unbehauenen Steinen, deren weniger raue Seite nach außen gekehrt ist, so dass die Wände ein ziemlich glattes Aussehen haben.
Ich glaubte im vorigen Jahr, bei Aufdeckung von Iliums großem Turm, dass derselbe einst höher gewesen sein müsse als er jetzt ist, nämlich 6 Meter oder 20 Fuss; seine glatt gemauerte Fläche neben dem Skaeischen Tor, sowie die weiterhin auf demselben befindlichen Bänke, nicht Ruinen, wie ich früher glaubte, beweisen aber, dass er nie höher gewesen sein kann. Ganz besonders mache ich darauf aufmerksam, dass das Mauerwerk des Skaeischen Tors bei dessen Aufdeckung noch so merkwürdig neu aussah, als ob es erst ganz kürzlich errichtet worden wäre. Bestimmt hat es mächtige hölzerne Verteidigungswerke, und wahrscheinlich auch einen hölzernen Turm oberhalb der Torflügel gehabt, denn sonst ist es mir unerklärlich, wie der Eingang zum Tor 10 Fuß hoch mit jener roten trojanischen Holzasche verschüttet, und namentlich wie dort, von anderen Bauten entfernt, die Glut so groß hat sein können, dass selbst die dicken Steinplatten davon zerstört worden sind.
Homer (Ilias, V, 638–642) spricht von einer dem trojanischen Krieg vorhergegangenen Zerstörung Trojas durch Herkules, und wird es uns ewig ein Rätsel bleiben, ob sich diese durch die Überlieferung bis zu seiner Zeit erhaltene Kunde wirklich auf das Ilium des Priamos oder auf die demselben vorausgegangene uralte Stadt der ersten Ansiedelung bezieht.
Für die Chronologie Trojas haben wir nur die allgemeine Annahme des Altertums, dass der trojanische Krieg ungefähr 1200 Jahre v. Chr. stattgefunden hat, und die Angabe Homers (Ilias, XX, 215–237), dass der erste trojanische König, Dardanos, Dardania gründete, welche Stadt ich mit Virgil und Euripides mit Ilium für synonym halte, und dass sie nach ihm von seinem Sohn Erichthonios, dann von seinem Enkel Tros, von seinem Urenkel Ilos, sowie von dessen Sohn Laomedon und Enkel Priamos beherrscht wurde. Wenn wir jedem dieser sechs Könige auch eine lange Regierung von 33 Jahren zugestehen, so bringen wir doch die Gründung der Stadt nur kaum auf 1400 Jahre v. Chr., also nur auf 700 Jahre vor der griechischen Kolonie.
Die Baustelle Trojas, welche zur Zeit der Gründung der Stadt 10 Meter unterhalb der jetzigen Oberfläche war, war nach der Zerstörung nur 7 Meter unterhalb derselben, als Ilium von einem andern Volk indogermanischen Stammes wieder aufgebaut wurde; ich finde nämlich in den Trümmerschichten dieses Volks, die von 7 bis 4 Meter unter der jetzigen Oberfläche reichen, die nämlichen Stücke Terrakotta mit religiösen Symbolen.
Da ich bei jedem Gegenstand in den photographischen Tafeln des Atlas genau die Tiefe vermerkt habe, in welcher er gefunden worden ist, so kann man leicht die von diesem Volk stammenden Sachen herausfinden. Die Töpferwaren dieser Nation haben Ähnlichkeit mit denen der Trojaner, sind aber schlechter und gröber, und es kommen viele neue Typen vor; fast alle Vasen haben auch hier eine Röhre an jeder Seite zum Aufhängen mit Schnüren. Ich fand hier, in 5 Meter Tiefe, das steinerne Stück einer Leier mit sechs Saiten, und in 4 Meter Tiefe das schön verzierte elfenbeinerne Stück einer anderen von sieben Saiten. Man findet beide Stücke in den fotografierten Tafeln des Atlas dargestellt.
Die Architektur dieses Volks war, wie man aus den vielen von mir aufgedeckten Hauswänden ersieht, durchgehende von kleinen mit Erde vereinigten Steinen; jedoch sieht man auch auf zwei Stellen in den Tiefen des Minervatempels eine Mauer von an der Sonne getrockneten Ziegeln, die dieser Nation anzugehören scheinen. Die Häuser derselben waren kleiner, und in denselben war weniger Holz verwandt, als in denen der Trojaner, denn obwohl die aufeinanderruhenden Hausreste mehrfache große Konvulsionen beurkunden, so findet man hier doch viel weniger verkohlte Trümmer als beim vorhergehenden Volk; ja diese Schuttschichten haben meistenteils ein graues oder schwarzes Aussehen, und sieht man in denselben Millionen kleiner Muschelschalen, Knochen, Fischgräten u. s. w. Merkwürdig ist es, dass sich in diesen Trümmerschichten gewisse Typen von Terrakottas nur genau in derselben Tiefe finden, und dass so z. B. die herrlichen schwarzen Becher in Form von Sanduhren und mit zwei großen Henkeln nur auf 6 Meter Tiefe beschränkt sind.
In den beiden ersten Jahren meiner Ausgrabungen fand ich in 4 bis 7 Meter Tiefe fast gar kein Kupfer und glaubte schon, Metall sei bei diesem Volk selten oder gar nicht bekannt gewesen. In diesem Jahr jedoch fand ich auch in diesen Trümmerschichten viele kupferne Nägel, auch einige Messer und Streitäxte und Formsteine aus Glimmerschiefer zum Gießen derselben und anderer Waffen und Werkzeuge. Immerhin muss Kupfer bei dieser Nation selten gewesen sein, denn steinerne Werkzeuge, wie Messer aus Silex, Hämmer und Beile aus Diorit u. s. w., kommen zu Tausenden vor.
Dem Anschein nach verschwand auch dieses Volk gleichzeitig mit der Zerstörung der Stadt, denn nicht nur finde ich von 4 Meter Tiefe aufwärts bis 2 Meter Tiefe viele neue Typen von Terrakotta-Gefäßen, sondern ich finde auch keine Reste von Hauswänden mehr; ja selbst die einzelnen Steine fehlen fast gänzlich. Jedenfalls wurde die Stadt sogleich nach der Zerstörung aus Holz wieder aufgebaut von einem verwandten Volk, denn die kleinen, mit entsprechenden religiösen Symbolen geschmückten Terrakottas, obwohl häufig mit neuen Typen, kommen auch in diesen Schuttschichten vielfältig vor. Es kommen zwar auch in diesen Tiefen Festungsmauern vor, aber diese waren schon von dem vorhergehenden Volk gebaut, wie z. B. die in 7 Meter Tiefe und 1½ bis 2 Meter oberhalb des Schatzes gegründete 6 Meter hohe Mauer, welche bis 1 Meter unter der Oberfläche reicht. Das hölzerne Ilium war dem Anschein nach noch weniger glücklich als die steinerne Stadt seiner Vorgänger, denn wie es die zahlreichen kalzinierten Trümmerschichten beweisen, wurde es vielfältig durch Feuer verheert. Ob diese Feuersbrünste zufällig ausbrachen oder durch Feindes Hand angelegt wurden, das muss uns ewig ein Rätsel bleiben; soviel ist aber gewiss und aus den aus diesen Tiefen stammenden Terrakottas ersichtlich, dass die von Anfang an geringe Zivilisation des Volks bei den fortwährenden Verheerungen seiner Stadt immer mehr verkrüppelte. Ich finde bei dieser Nation Lanzen, Streitäxte sowie Werkzeuge aus reinem Kupfer und Formsteine zum Gießen derselben; auch eine Menge kupferner Nägel, die aber – gleich wie bei allen vorhergehenden Völkern, die diesen Berg bewohnt haben – zu lang und dünn sind, um zum Festschlagen in Holz verwandt worden zu sein, und jedenfalls als Brustnadeln gebraucht sein müssen; dass dem so ist, scheinen auch zwei solcher kupferner Nägel zu beweisen, an deren oberem Teil ich Reihen von durchbohrten Perlen aus Gold oder Elektron festgeschmiedet fand. Diese beiden kupfernen Nägel wurden zwar unmittelbar unter der Oberfläche gefunden, müssen aber jedenfalls der vorgriechischen Zeit angehören.
Steinerne Werkzeuge, wie z. B. Hämmer und herrlich geschliffene Beile und Streitäxte aus Diorit, kommen auch bei diesem Volk in 4 bis 2 Meter Tiefe vor, aber bedeutend weniger als bei dem vorhergehenden.
Als die Oberfläche des Bergs um 2 Meter niedriger war als sie jetzt ist, wurde Ilium von einer griechischen Kolonie aufgebaut, und haben wir bereits versucht, nachzuweisen, dass diese Niederlassung ungefähr um 700 v. Chr. erfolgt sein muss. Von nun an findet man Reste hellenischer Hauswände aus ohne Zement zusammengelegten großen behauenen Steinen; von ungefähr 1 Meter unter der Oberfläche aufwärts auch Trümmer von Bauten, deren Steine mit Zement oder Kalk verbunden sind. Kupferne Medaillen Iliums aus der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Constans II. und Konstantin II. sowie ältere ilische Münzen mit dem Bild der Minerva und Medaillen von Alexandria Troas kommen in großer Menge vor, auch einige Münzen von Tenedos, Ophrynium und Sigeion, einzeln bis 1 Meter, aber größtenteils in weniger als 50 Zentimeter unter der Oberfläche. Ich habe einmal irrtümlich bemerkt, dass hier auch byzantinische Münzen nah an der Oberfläche vorkommen. Aus späterer Zeit als Constans II. und Konstantin II. habe ich hier aber in meinen dreijährigen Ausgrabungen nicht eine einzige Medaille gefunden, ausser zwei schlechten Münzen eines byzantinischen Klosters, die von Schäfern verloren sein mögen; und da hier jede Spur von byzantinischem Mauerwerk oder byzantinischer Töpferware durchaus fehlt, so ist als bestimmt anzunehmen, dass das Ilium der griechischen Kolonie gegen Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. untergegangen und nie wieder ein Dorf, geschweige denn eine Stadt auf seiner Baustelle errichtet worden ist. Die in meinem Aufsatz vom 1. März 1873 von mir erwähnte, aus mit Zement vereinigten korinthischen Säulen bestehende Mauer, die ich aus dem Mittelalter zu stammen glaubte, muss jedenfalls aus der Zeit Konstantins I. oder Constans’ II. stammen, als der Minervatempel durch den frommen Eifer der ersten Christen zerstört wurde.
Von den Mauern und Festungswerken dieser griechischen Kolonie sind hauptsächlich nur die anscheinlich von Lysimachos erbauten erhalten geblieben, und sieht man von denselben auf Tafel 109, gleich links, eine Bastion, sowie auf Tafel 112 eine Mauer. Aus älterer Zeit, und wahrscheinlich vom Anfang der griechischen Kolonie, stammt der untere, hervorstehende Teil der Turmmauer, die man auf Tafel 212 in dem Einschnitt auf jener Seite des Skaeischen Tors sieht. große politische Konvulsionen oder Katastrophen scheinen fortan wenig oder gar nicht mehr vorgekommen zu sein, denn die Schuttaufhäufung beträgt während der langen Dauer der griechischen Kolonie, sage während 10½ Jahrhunderten, nur 2 Meter.
Merkwürdigerweise finde ich in diesen griechischen Trümmerschichten äußerst wenig Metall; ein halbes Dutzend sichelförmiger Messer, eine zweischneidige Axt, ein paar Dutzend Nägel, ein Becher, ein paar Lanzen und Pfeile u. s. w. sind so ziemlich alles was ich fand; ich beschrieb diese Gegenstände in meinen Aufsätzen und im Katalog als aus Kupfer; wie sich aber bei näherer Untersuchung herausgestellt hat, sind sie aus Bronze, und kommt reines Kupfer in der griechischen Kolonie nicht mehr vor. Aus Eisen fand ich nur ganz nah an der Oberfläche einen Schlüssel merkwürdiger Form und ein paar Pfeile und Nägel. Wie wir aus Homer wissen, hatten auch die Trojaner Eisen, ja sogar das von ihm χύαονς genannte Metall, welches man schon im Altertum durch χάλυψ (Stahl) übersetzte. Ich beteuere aber, weder bei den Trojanern, noch bei irgendeinem der andern der griechischen Kolonie vorangegangenen Völker, die diesen Berg bewohnt haben, auch nur eine Spur von diesen Metallen gefunden zu haben. Es mögen aber immerhin eiserne und stählerne Gerätschaften dagewesen sein; ja ich glaube ganz bestimmt, dass sie dagewesen sind, sie sind aber spurlos verloren gegangen; denn bekanntlich zersetzt sich Eisen und Stahl viel leichter als Kupfer. Von Zinn, dessen Homer so vielfältig erwähnt, fand ich natürlich keine Spur, denn dies Metall zersetzt sich bekanntlich mit großer Schnelligkeit, selbst wenn es an einem trocknen Ort liegt. Blei kam bei allen Völkern vor, die diesen Berg bewohnt haben, bei den Völkern vor der griechischen Ansiedlung aber hauptsächlich nur in Klumpen, in Form von Halbkugeln. Nur erst in der griechischen Kolonie finde ich es in allgemeinem Gebrauch, und sogar als Verbindungsmittel von Bausteinen angewandt. Nach der Größe der Baustelle des Iliums der griechischen Kolonie zu urteilen, mag dasselbe 100.000 Einwohner gehabt haben und muss in seiner Blütezeit sehr reich gewesen sein, und die plastische Kunst muss hier einen hohen Grad von Vollkommenheit erreicht haben. Die mit den Trümmerhaufen großartiger Bauten bedeckte Baustelle ist nämlich mit Bruchstücken von ausgezeichneten Skulpturen übersät, und der hier in den Tiefen des Apollotempels von mir entdeckte und jetzt meinen Garten in Athen zierende 2 Meter lange, 86 Zentimeter hohe herrliche Triglyphenblock mit einer Metope, welche den Phöbus Apollo mit den vier Rossen der Sonne darstellt, ist eins der erhabensten Meisterwerke, welche uns aus der Blütezeit der griechischen Kunst erhalten sind.
In der Beschreibung, welche ich sogleich nach der Entdeckung dieses Kunstschatzes in meinem Aufsatz vom 18. Juni 1872 machte, bemerkte ich, dass dies Kunstwerk aus der Zeit des Lysimachos, sage ungefähr vom Jahr 306 ν. Chr. stammen müsse. Ich schickte einen Gipsabguss davon an das Museum für Gipsabgüsse in München, und schreibt mir der Vorsteher desselben, Professor H. Brunn, welcher jedenfalls eine der größten Autoritäten der Welt für die plastischen Kunstwerke des Altertums ist, wie folgt darüber: „Selbst Fotografien reichen doch zur Beurteilung plastischer Werke nie ganz aus, und hat mir auch hier erst der Abguss die volle Gewissheit gegeben, dass dieses Werk weit günstiger beurteilt werden muss, als es in der archäologischen Zeitung geschehen ist. Ich wage nicht, über die Triglyphen bestimmt abzusprechen: die Geschichte des dorischen Stils nach der Zeit des Parthenon und der Propyläen liegt noch durchaus im argen, doch lässt sich der gerade Abschnitt der Cannele gewiss in vorrömischer Zeit nachweisen. Von äusseren Kriterien bleibt so zunächst der Strahlenkranz. Nach den Untersuchungen von Stephani (Nimbus und Strahlenkranz) kommt derselbe erst etwa in der Zeit Alexanders des großen vor. Für die spezielle Form, lange und kurze Strahlen, haben wir die von Curtius angeführten Münzen Alexanders I. von Epirus und von Keos, resp. Karthaea. Das jüngste Beispiel, welches ich bis jetzt gefunden, bietet die Unterweltsvase von Canosa im hiesigen Museum, die spätestens in das 2. Jahrhundert v. Chr. gehört; so wären also für das Relief die äußersten Termini etwa Ende des 4. und Mitte des 2. Jahrhunderts. Künstlerisch zeigt die Komposition die größten Feinheiten in der Lösung eines schwierigen Problems. Das Viergespann soll sich nämlich nicht in der Relieffläche bewegen, sondern so erscheinen, als ob es in halber Wendung aus derselben herauskomme. Das ist besonders dadurch erreicht, dass der rechte Hinterschenkel des Pferdes im Vordergrund stark zurückgedrängt ist, während der linke Fuß vorschreitet, dass außerdem dieses Pferd in leiser Verkürzung gebildet ist, dass die Fläche jenes Schenkels tiefer liegt als die obere Fläche der Triglyphen, die Fläche des Vorderbuges und des Halses dagegen etwas höher, während der Kopf, um das Gesetz des griechischen Reliefstils zu wahren, wieder mit der Grundfläche ziemlich parallel steht. Darum fehlt auch jede Andeutung eines Wagens, der durch das vordere Pferd verdeckt zu denken ist. Dann ist auch die Stellung des Gottes, dem Kopf einigermaßen folgend, halb nach vorne gewendet, und nur um auch hier die Stellung mit dem Reliefgesetz in Konflikt zu bringen, ist der Arm wieder stark nach innen gewendet. Wenn man sodann in dem Übergreifen des Kopfes auf die obere Leiste des Triglyphs eine Inkorrektheit hat sehen wollen, so finde ich darin einen besonders glücklichen Gedanken, der wohl an die freilich wieder verschiedene Auffassung am Parthenongiebel erinnern darf, wo Helios nur erst mit Kopf und Schultern aus dem Wagen des Ozeans auftaucht. Hier bricht Helios sozusagen aus den Pforten des Tags hervor und überstrahlt mit seinem Glanz das All. Das sind Feinheiten, wie sie nur der griechischen Kunst in ihrer vollen Kraft eigen sind. Die Ausführung entspricht durchaus dem Verdienst der Ideen, und so stehe ich nicht an, das Relief näher an den Anfang als an den Schluss des oben begrenzten Zeitraums zu setzen. Wenn Sie daher auch aus andern Gründen an die Zeit des Lysimachos denken, so habe ich dagegen von archäologischer Seite durchaus keine Einwendung zu machen, freue mich vielmehr, unseren Monumentenschatz mit einem Originalwerk aus jener Zeit bereichert zu sehen.“
Ich bewies vorhin die Verwandtschaft der vier verschiedenen Völker, welche die Baustelle Trojas vor Ankunft der griechischen Kolonie bewohnt haben, durch die bei allen massenweise vorkommenden kleinen Terrakotta-Vulkane und -Karusselle und durch die Ähnlichkeit der auf denselben eingravierten religiösen Symbole. Ich beweise diese Verwandtschaft ferner und vor allen Dingen durch die plastische Darstellung der Minerva, der Schutzgöttin Iliums, mit einem Eulengesicht, denn diese Darstellung ist allen vier Völkern eigen, welche hier der griechischen Kolonie vorausgegangen sind. Sogleich unter den Trümmerschichten der letzteren, in 2 Meter Tiefe, fand ich dies Eulengesicht mit einer Art von Helm auf Terrakotta-Bechern, die auch in allen folgenden Schuttschichten, bis in 12 Meter Tiefe, vorkommen und sich bis in 9 Meter Tiefe sehr häufig finden. Diese Becher mögen auch, wie mein gelehrter Freund Emile Burnouf meint, nur als Deckel der gleichzeitig mit ihnen vorkommenden
Vasen mit zwei emporstehenden Flügeln, zwei Frauenbrüsten und einem großen Schamteil gedient haben, denn sie passen vollkommen auf dieselben. Ich fand gleichzeitig von 3 Meter Tiefe abwärts in allen Trümmerschichten bis zu 10 Meter Tiefe Vasen mit Eulengesichtern, zwei emporstehenden Flügeln (nicht Armen, wie ich früher meinte), zwei großen Frauenbrüsten und einem sehr großen Schamteil, und sogar, in 6 Meter Tiefe, eine Vase, auf welcher der Schamteil mit einem Kreuz und vier Nägeln verziert ist. Ich fand selbst in 14 Meter Tiefe den oberen Teil einer Vase und die Scherbe einer Schüssel mit Eulengesichtern geschmückt. Außerdem fanden sich von 2 Meter Tiefe abwärts in allen Schuttschichten bis zum Urboden 2½ bis 18½ Zentimeter lange und 1½ bis 12 Zentimeter breite Idole aus sehr feinem Marmor, aus Knochen, aus Glimmerschiefer, aus Schiefer oder selbst aus ganz ordinärem Kalkstein; auf sehr vielen derselben sieht man ein Eulengesicht, und auf einigen außerdem sogar Frauenhaar auf der Stirn eingraviert; auf vielen sieht man auch einen Frauengürtel eingeschnitten. Da ich auf mehreren Idolen ohne eingeschnittenen Eulenkopf diesen mit roter oder schwarzer Farbe dargestellt finde, so vermute ich, dass ein Gleiches einst mit allen Idolen der Fall war, auf welchen die Kennzeichen der Eule jetzt fehlen, und dass auf diesen die Farbe im Laufe der Jahrtausende durch die Feuchtigkeit verloren gegangen ist. Auf mehreren Idolen aus Marmor oder Knochen sind die Flügel an den Seiten angedeutet. Ich fand aber auch den versteinerten Wirbelknochen eines antediluvianischen Tiers, auf welchem die Trojaner einen großen Eulenkopf ausgeschnitten haben. Ferner fanden sich in 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 14 Meter Tiefe zwölf Idole aus Terrakotta, und sind, nur mit einer Ausnahme, auf allen Eulengesichter; die meisten haben auch zwei Frauenbrüste und auf der Rückseite angedeutetes langes Frauenhaar. Eins dieser eulenköpfigen Idole ist in Form eines Gefäßes und hat an jeder Seite einen Schlauch in Gestalt eines kleineren Gefäßes; der vordere Körper der Göttin bis zum Hals ist bedeckt mit einem langen Schild, und auf der Rückseite sieht man das Frauenhaar, auf Art der Karyatiden in der Akropolis in Athen, lang herunterhängen. Auch auf mehreren dieser Idole von Terrakotta sind Flügel angedeutet.
Diese auf Bechern, Vasen und Idolen vielfältig vorkommenden Eulengesichter mit Frauengestalt können nur eine Göttin darstellen, und diese Göttin kann nur Minerva, die Schutzgöttin Trojas, sein um so mehr als sie Homer fortwährend „θεα γλανχῶπις Ἀθήνη“ nennt; denn „γλανχῶπις“ ist von den Gelehrten aller Jahrhunderte falsch übersetzt, und bedeutet nicht „mit feurigen oder funkelnden Augen“, sondern es bedeutet „mit Eulengesicht“. Die natürliche Schlussfolgerung ist, erstens, dass es dem Homer vollkommen bekannt war, dass Minerva mit dem Eulengesicht Iliums Schutzgöttin war; zweitens, dass der Ort, in dessen Tiefen ich seit drei Jahren wühle, die Stätte sein muss „ubi Troja fuit“; und drittens, dass bei fortschreitender Zivilisation Pallas Athene ein menschliches Gesicht erhielt und aus ihrem frühem Eulenkopf ihr Lieblingsvogel, die Eule, gemacht wurde, welche als solcher dem Homer ganz unbekannt ist.
Es kommen in 4 bis 9 Meter Tiefe auch einige Vasen und Becher mit einem Menschengesicht vor, welches aber vieles von der Eule hat.
Da ich keine Spur des Eulengesichts in den Trümmerschichten der griechischen Kolonie finde, so ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass diese schon weiter in der Kultur fortgeschritten war als die Ilier, deren Stadt sie in Besitz nahm, und dass sie schon die Vorstellung der Schutzgöttin mit menschlichem Gesicht mit nach Troja brachte.
Was die mehrfach erwähnten, mit religiösen Symbolen geschmückten runden durchbohrten Stücke Terrakotta in Gestalt des Karussells oder des Vulkans betrifft, so ist es immerhin möglich, dass ihre ursprüngliche Form die des Rades gewesen ist, denn in dieser Gestalt kommen sie mehrfach auf dem Urboden, in 14 und 16 Meter Tiefe vor. In den höheren Schuttschichten ist zwar bei diesen Stücken die Form des Rades selten, aber die durch Einschnitte bewirkte Darstellung des in Bewegung befindlichen Rades kommt doch noch sehr häufig vor. Trotz allen Forschens und Grübelns ist es mir noch nicht gelungen, zur Einsicht zu kommen: zu welchem Zweck diese äußerst interessanten Gegenstände gebraucht worden sind, die, wie sich jetzt beim Ausgraben des Minervatempels herausgestellt hat, nur bei den der griechischen Kolonie vorangegangenen Völkern mit indogermanischen symbolischen Zeichen geschmückt worden sind, in der griechischen Ansiedlung aber nur noch einzeln, auch in abweichender Form und ganz ohne eingeschnittene Verzierungen vorkommen und durch die runden und viel größeren zweimal durchbohrten Stücke Terrakotta ersetzt werden, welche hin und wieder eine Art von Stempel tragen.
Durch die Güte meines geehrten Freundes, des Professors Giuseppe G. Bianconi in Bologna, erhielt ich die Zeichnungen von zehn solchen, sich im Museum von Modena befindenden, runden Stücken Terrakotta in der Form des Karussells und des Vulkans, welche in den Terramares der dortigen Gegend, in den Pfahlbauten aus der Steinzeit, gefunden wurden. Zu meinem größten Erstaunen sehe ich darunter sechs mit den nämlichen eingeschnittenen Verzierungen, die ich auf den Stücken gleicher Gestalt hier in Troja finde. Drei derselben haben im Kreise um die Zentralsonne ein dreifaches Kreuz, welches, wie ich bemüht gewesen bin in meinem sechsten Aufsatz ausführlich auseinanderzusetzen, als Bild der beiden Hölzer unserer Urväter zur Hervorbringung des heiligen Feuers, ein Symbol höchster Wichtigkeit war; das vierte stellt eine solche Feuermaschine mit fünf Enden dar, und werden die Indologen vielleicht finden, dass einer der Stäbe das „pramantha“ genannte Stück Holz darstellt, womit das Feuer durch Reibung hervorgebracht wurde und von dem die Griechen in späterer Zeit den Prometheus machten, den sie das Feuer vom Himmel stehlen ließen. Das fünfte zeigt eine etwas verschiedene Form der Feuermaschine unserer Urväter, und das sechste hat zwölf Kreise um die Zentralsonne. Wahrscheinlich sind dies die im Rigveda so oft vorkommenden zwölf Stationen der Sonne, welche personifiziert sind durch die zwölf Adityas, Söhne des Adity (des Unteilbaren oder des unendlichen Raumes), und die zwölf Zeichen des Tierkreises darstellen.
Derselbe Freund schickte mir auch die Zeichnungen von achtzehn solchen, aus den Gräbern des Kirchhofs von Villanova stammenden und im Museum des Grafen Gozzadini in Bologna befindlichen runden Stücken Terrakotta. Da der Graf in einem der Gräber ein „aes rude“ gefunden hat, so glaubt er, dass, so wie dies, so auch der Kirchhof, aus der Zeit des Königs Numa stamme und somit aus zirka 700 v. Chr. G. de Mortillet (Le Signe de la Croix, S.88–89) hingegen schreibt dem Kirchhof ein viel größeres Alter zu. Jedenfalls aber haben fünfzehn der vorliegenden achtzehn Zeichnungen, im Vergleich zu den zehn im Museum von Modena, sowie auch im Vergleich mit meinen hier in Troja gefundenen kleinen Karussells, Vulkanen und Rädern, ein modernes Aussehen, denn nicht nur die Verzierungen, sondern auch die Form der Stücke sind viel mehr gekünstelt. Nur drei der achtzehn Stücke zeigen eine Gestalt und Verzierungen, wie sie auch hier in Troja vorkommen. Alle drei haben die Form des Karussells; das eine hat sieben Sonnen im Kreis um die Zentralsonne; das zweite hat zwei Kreuze, deren eins durch vier Sterne, das andere durch vier Striche gebildet wird. Das dritte hat fünf fünffache Dreiecke und fünf Sterne im Kreise um den Mittelpunkt. Der Vergleich dieser achtzehn Stücke mit den trojanischen bringt mich zur Überzeugung, dass Graf Gozzadini recht hat, wenn er dem Kirchhof von Villanova kein höheres Alter als 700 v. Chr. zuschreibt.
Außer den mit religiösen Symbolen verzierten Stücken kommen aber auch in Troja Tausende von Terrakottas ähnlicher, aber meistens mehr gedehnter Form vor, die gar keine Verzierungen haben; in 3 Meter Tiefe kommen sie auch in Gestalt des Kegels vor. Früher fand ich in 3 Meter Tiefe solche Stücke auch aus blauem oder grünem Stein, die ich in letzter Zeit aber auch in 7 bis 10 Meter Tiefe häufig antraf. Unter den unverzierten Terrakottas dieser Art finde ich einige, aber kaum mehr als 2 Prozent, die einige Abnutzung zeigen und am Spinnrad gebraucht sein mögen. Die mit Einschnitten verzierten Stücke dagegen zeigen niemals irgendwelche Abnutzung, und die auf denselben eingravierten symbolischen Zeichen sind mit einer weißen Tonerde ausgefüllt, damit sie mehr in die Augen fallen.
Diese Aussage bedarf einer zusätzlichen Erläuterung: Die Notizen Hr. Burnouf Zeichnungen, die Dr. Schliemann für dieses Buch geliefert hat, beschreiben häufig die verzierten Karusselle als abgegriffen und abgenutzt, speziell an der unteren Seite und durch eine drehende Bewegung. Dies unterstützt die These, dass es sich dabei um Spindeln zum Spinnen handelt. (Anm. der englischen Ausgabe)
Diese weiße Tonerde hätte beim Gebrauch der Stücke am Spinnrad oder als Münze sogleich verloren gehen müssen. Als Amulette können die Stücke ihrer Größe und Schwere wegen nicht getragen worden sein. Ich muss daher glauben, dass sie als Opfergaben angewandt oder als Idole der Sonne angebetet wurden, deren Bild man im Mittelpunkt sieht. Wie es leider bei der Größe meiner Ausgrabungen, bei der Eile, mit welcher dieselben betrieben wurden, und bei der Härte des Schutts nicht anders möglich war, kam bei weitem der größere Teil der von mir in den Tiefen Iliums gefundenen Terrakotta-Gefäße in mehr oder weniger zerbrochenem Zustand heraus. Ich habe aber alles, was nur irgend repariert werden konnte, mittels Schellack und Gips wiederhergestellt, und tritt letzterer in den Photographien hervor. Überall wo von einem Teil etwas abgebrochen war und fehlte, habe ich denselben nach dem Modell anderer heil herausgekommener Gefäße derselben Art restauriert; wo mir aber ein solches Modell entbrach, oder wo ich die geringste Ungewissheit hatte, da habe ich die Restauration ganz unterlassen.
Die Stadt Ilium, auf deren Baustelle ich seit mehr als drei Jahren gegraben habe, gab sich für die Nachfolgerin von Troja aus, und da im ganzen Altertum der Glaube an die Identität seiner Baustelle mit jener der alten Stadt des Priamos fest begründet war und niemand daran gezweifelt hat, so ist es gewiss, dass die gesamte Tradition diese Identität bestätigte. Endlich erhob sich dagegen Strabo, der jedoch, wie er selbst sagt, die Ebene von Troja niemals besucht hatte und sich auf die von Eigennutz eingegebenen Berichte des Demetrius von Skepsis verließ. Nach Strabo (ΧΙII, 1, S. 122, Tauchn. Ausg.) behauptete dieser Demetrius, seine Geburtsstadt, Skepsis, sei die Residenz des Aeneas gewesen, und beneidete Ilium um die Ehre, die Hauptstadt des trojanischen Reichs geworden zu sein. Deshalb sprach er die Ansicht aus: in Ilium und Umgegend sei für die großen Taten der Ilias nicht Raum genug, und das ganze Terrain, welches die Stadt vom Meer trennte, sei angeschwemmtes Land und habe sich erst nach dem trojanischen Kriege gebildet. Als einen anderen Beweis, dass die Stelle der beiden Städte nicht dieselbe sein könnte, führt er an: Achilles und Hektor seien dreimal um Troja gelaufen, während man um Ilium nicht herumlaufen könnte „διά τήν δυνεχῆ ῥάχην“, wegen des fortlaufenden Bergrückens. Aus allen diesen Gründen müsse man das alte Troja an die Stelle von Ἰλιέων χώμη, 30 Stadien von Ilium und 42 Stadien von der Küste, verlegen, obwohl er allerdings zugestehen muss, dass sich nicht die geringste Spur davon erhalten habe (Strabo, ΧΙII, 1, S. 99).
Strabo würde gewiss bei dem ihn kennzeichnenden richtigen Urteil alle diese irrtümlichen Behauptungen des Demetrius von Skepsis verworfen haben, wenn er selbst die Ebene von Troja besucht hätte, da sie sich leicht widerlegen lassen.
Ich bemerke zunächst, dass man um die Baustelle von Troja sehr bequem herumlaufen kann, ferner, dass die Entfernung von Ilium, in gerader Linie bis zur Küste, 6 Kilometer, dagegen in gerader nordwestlicher Linie bis zum Vorgebirge von Sigeum (oder Sigeion) 7 Kilometer beträgt, welches die Tradition noch zu Strabos Zeit als die Stelle des griechischen Lagers bezeichnete. Strabo sagt nämlich (XIII, 1, S. 103): „Nahe Rhoeteum sieht man die zerstörte Stadt Sigeum, den Hafen der Achäer, das achäische Lager und den Sumpf oder See, Stomalimne genannt, und die Mündung des Skamanders.“
Auf der Baustelle von „Ἰλιέων χώμη“ habe ich im November 1871 Ausgrabungen gemacht, deren Resultat die Theorie des Demetrius von Skepsis vollkommen umwirft, denn überall fand ich den Urboden in weniger als ½ Meter Tiefe, und die auf einer Seite der Baustelle weit fortlaufende Anhöhe, welche die Trümmer einer großen Stadtmauer zu bergen scheint, enthält nur rein

















